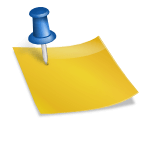Ansichten & Aussichten
Einrichten in der Angst
Gesellschaften stürzen nicht. Sie rutschen, dann erreichen sie Kipppunkte. Manchmal merkt es jemand früh genug. Das ist dann vielleicht die letzte Ausfahrt.
Von Miriam Rosenlehner Sonntag, 04.05.2025, 11:44 Uhr|zuletzt aktualisiert: Sonntag, 04.05.2025, 11:44 Uhr Lesedauer: 11 Minuten |
Ich stehe auf dem Balkon, die Hände in die Hüften gestemmt, und lächle in den viel zu frühen Sommerhimmel. Mein ganzer Körper schmerzt, aber ich spüre die Schmerzen jetzt anders. Stärker, deutlicher, so als gehörten sie wirklich zu mir. Aber auch so, als könnten sie nachlassen. Ich spüre meinen Körper wieder bis zu seinen Enden. Ich nehme ihn wahr, wie er in der Welt steht. Ich atme: Einer hat funktioniert.
Einer der Mechanismen der wehrhaften Demokratie hat funktioniert.
Und es ist dieser Moment, in dem ich denke: Jetzt lohnt es sich wieder, mitzuschreiben. Vielleicht ist das hier die langersehnte Ausfahrt. Raus aus der falschen Spur.
Niemand antwortete, zuletzt nicht mal ich
In den letzten Monaten war ich sprachlos geworden. Ich hatte meine Kraft zu schreiben verloren. Nichts von dem, was ich schrieb, drang durch. Nirgendwo, nicht mal zu mir selbst. Ich hatte Strategien entwickelt, um klarzukommen. Aber sie begannen zu versagen. Ich hörte langsam auf, mich zu spüren. Schmerzen fühlten sich an, als gehörten sie nicht zu mir. Lächeln wurde eine Gesichtsbewegung, das Gefühl dazu hatte ich manchmal vergessen.
Immer wieder und von allen Seiten: Du siehst Gespenster. Ist doch nicht so schlimm. Ich verstehe nicht, was du meinst. Übertreib nicht. Von einem ganzen Land gegaslightet zu werden, von den Nachrichten, vom Umfeld – das hat eine andere Qualität. Es blieb nicht im Kopf. Langsam übernahm es meinen Körper.
In Gesprächen wurde mir immer wieder klar: Die Menschen sehen das nicht. Am Tag, an dem die offensichtlich rechtsextremistische Partei nach Umfragen stärkste Kraft war, fragte ich: „Wann genau fangen wir an, uns Sorgen zu machen?“ Betroffene Gesichter.
Faschismus ist, wenn sich eine Gesellschaft in der Angst einrichtet
So viele Warnzeichen wurden übersehen. Und manche begannen sich einzurichten, als gehörte das alles jetzt zum Alltag. Ich hörte jemanden sagen: „Wir werden in der politischen Bildung künftig damit leben müssen, dass Meinungen, die wir früher als rassistisch bezeichnet haben, nun Teil des Meinungsspektrums sind.“ Man könnte das Resignation nennen, oder Realismus. Aber ich halte es für Anpassung.
Anpassung, die bei vielen innerhalb von wenigen Monaten eintrat. Ich dachte: Du musst das aufschreiben. Du musst dokumentieren, wie die Angst um sich greift, wie sie sich in den Köpfen einnistet. Aber alles davon war schon geschrieben worden. Beim letzten Mal. Damals hatte es noch Sinn gemacht mitzuschreiben. Um zu warnen. Um zu verstehen. Man glaubte, dass das alles ein Fehler im System sei. Dass die Weimarer Verfassung zu schwach war, dass es ihre fehlenden Abwehrmechanismen waren, die dem Faschismus die Tür geöffnet hatten. Dass das am Ende niemand gewollt haben konnte. Also – bis auf ein paar Wahnsinnige. Der Faschismus als eine Art Unfall. Damals glaubte man, dass die Mehrheit, wenn sie nur wüsste, was passiert, das Kippen der Demokratie verhindern würde. Schreiben gab dem Leid einen Sinn. Der Sinn hieß: Nie wieder.
Heute denken wir, Faschismus ist, wenn Rechtsextremisten regieren. Aber wenn sie in den Kommunen regieren, korrigieren wir: Wir müssen das erst problematisch finden, wenn Rechtsextremisten auf Bundesebene regieren. Und wir werden wieder korrigieren. Weil Faschismus ist, wenn sich eine Gesellschaft in der Angst einrichtet.
Der eigentliche Punkt ist vielen noch immer nicht bewusst. Es sind nicht die paar Irren, die bereit wären zu töten. Die sind nicht das Zentrum. Es ist die Gesellschaft, die es zulässt. Faschismus ist kein lauter Umsturz. Er kriecht. Er ernährt sich von der Angst der Mehrheit, von der Lethargie, dem Schweigen, sich einrichten und anpassen. Faschismus ist eine gesellschaftliche Bewegung des Ermöglichens.
Die letzten Wahlen finden erst nach solchen Prozessen statt. Und ob die nächsten die letzten Wahlen sind, das wissen wir erst danach. Abwarten ist also keine Option.
Gespräche mit meinem jüngeren Ich
Während ich vor einem leeren Blatt sitze, sitzt neben mir meine innere Neunzehnjährige. Mein junges Ich. Sie ist oft da in letzter Zeit. Damals in der Studentenbude saß sie auf dem Bett. Sie hatte die Jalousien heruntergelassen. Drei Tage verließ sie die Wohnung nicht und las. Neben ihr auf dem Boden der Stapel Bücher aus der Stadtbibliothek. Berichte aus dem Frauenlager Ravensbrück, Berichte über die Todesmärsche, und wie Sterbende am Wegrand zusammenbrachen. Wie sie durch Dörfer gingen und die Menschen ihre Türen schlossen, um später zu sagen, sie hätten nichts gesehen. Der Alltag im Konzentrationslager und wie die Unmenschlichkeit systematisch von der Lagerleitung bis zu den Insassen in die Knochen kroch, wie die Würde zersetzt wurde. Kleinigkeiten, wie die Bezeichnung KZ, die wir heute verwenden. Die Fotos von vergilbtem Papier, schreibmaschinengeschriebenen Listen und der Abkürzung KL für Konzentrationslager oben rechts, statt KZ, wie wir es erwarten würden. Bilder der Toten und wie ein verhungerter und gequälter Körper nicht mehr als Gleicher zu erkennen ist: Systematische Entmenschlichung. Mauthausen, Treblinka, Ausschwitz. Eine Übersichtskarte der Lager, auf der nicht alle 40.000 Platz haben: Lager, Haftstätten und Gefängnisse, Ghettos, Zwangsarbeiterlager, Durchgangslager, Erschießungsplätze. Überlebendenberichte. Tagelang, keine Pause.
Und immer wieder die Überraschung derer, die berichten: Das hätte ich nicht gedacht. Dass das passiert, war unvorstellbar.
So dachten manche noch, als sie den Rauch der Schornsteine über Ausschwitz sahen. Sowas dachten andere, als der Verwesungsgeruch über dem ganzen Landstrich lag.
Als ich die Jalousien wieder öffnete, hatten wir eine Abmachung, die Neunzehnjährige mit ihrem älteren Ich: Ich würde nicht zu spät gehen.
Alle diese Bilder sind nach Jahrzehnten noch da. Ich erinnere mich, wie das Zimmer dämmrig war. Wie das Grauen aus diesen Büchern sickerte und wie ich die Verantwortung spürte, das wissen zu müssen. Das unbedingt und so genau wie möglich wissen zu müssen. Zu meinem Schutz und aus Respekt vor den Opfern. Weil man verstehen muss, wie es so weit kommen konnte. Was ist passiert? Was ist genau passiert? Wie war das möglich? Denn die Täter waren Menschen. Wenn diese Menschen so etwas tun konnten – können andere es wieder tun. Nicht schwer zu verstehen, oder?
Ich habe mir damals nicht versprochen zu kämpfen. Ich habe mir versprochen zu gehen.
Jetzt sitze ich hier und verstehe, warum sie nicht gegangen sind. Selbst die, die wussten oder ahnten, was passierte. Ich verstehe jetzt das, was ich als Neunzehnjährige nicht verstand: Ich habe Bücher gelesen, aber wir können die Wahrheit nicht aufschreiben. Was wir schreiben, ist immer nur ein Bild der Wahrheit.
Die Wahrheit ist: Wohin gehen? Wie aufbrechen? Wen zurücklassen? Nochmal ganz von vorne anfangen? Alles verlieren? Auch meine Muttersprache – die mir das Schreiben ermöglicht? Die Wahrheit ist echt, kein Bild.
Und trotzdem, das was ich weiß, wussten sie damals nicht. Ich hätte vorbereitet sein sollen. Aber ich habe es einfach zu lange nicht geglaubt. Ganz ohne Grundlage, ohne Beweis und gegen besseres Wissen. Ich hab‘ es nicht besser gemacht.
Und mitten in diese aussichtslose Lage, in der meine innere Neunzehnjährige mich anschreit – Du hast es versprochen! Beweg dich! Du hast gesagt, du würdest nicht zu spät gehen! Hör auf, mir was erklären zu wollen. Du hattest nur diese eine Aufgabe! – kommt auf meinem Handy die Nachricht. Ein Link. Eine Schlagzeile.
Die Einschätzung des Verfassungsschutzberichts: AfD gesichert rechtsextremistisch
Ich wusste gar nicht, was alles aufhört, wenn ein Land aufhören muss, einen zu gaslighten. Aber ich spürte sofort: Das wird etwas ändern. Es hat etwas geändert. Schon beim Lesen der Schlagzeile. Ist das Hoffnung?
Wer jetzt noch mit dieser Organisation zusammenarbeitet, muss es sich sagen lassen. Das Wegducken, sich einrichten, irgendwie kollaborieren und dabei ein Gesicht machen, als hätte man Bauchschmerzen, das ist jetzt vorbei. Wer jetzt noch mitmacht, dem darf man es laut sagen: Mitläufer. Steigbügelhalter für Rechtsextremisten.
Die Verteidigungsarchitektur der Demokratie und ihre Feinde
Ich bin ein großer Fan des Grundgesetzes. Es ist ein Text, der mit gesellschaftlichen Dynamiken arbeitet. Die, die ihn geschrieben haben, wussten, wovon sie reden. Sie haben versucht, sich vorzustellen, wie es das nächste Mal anfangen könnte – und sie haben Schutzmechanismen eingebaut. Sicherheitsnetze. Klug durchdacht.
Alles beginnt mit Artikel 1 – der Erklärung, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Nicht relativierbar, nicht auslegbar, nicht abhängig von Herkunft, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft.
Beamt:innen zum Beispiel sind nicht der Regierung verpflichtet, sondern dem Grundgesetz. Und wenn ihnen eine Anweisung erteilt wird, die dem widerspricht, dann gilt nicht Gehorsam, sondern Widerspruch. Nicht aus Mut, sondern aus Pflicht. Das nennt man Remonstration.
Die Schulen haben einen Bildungsauftrag – nicht nur zur Wissensvermittlung, sondern zur Demokratiebildung. Der Staat ist an Recht und Gesetz gebunden. Dazu kommen die einzelnen Artikel, die das Miteinander regeln: Artikel 3 zum Beispiel verbietet Diskriminierung – wegen Herkunft, wegen Geschlecht, wegen Religion oder Behinderung. Die Meinungsfreiheit ist garantiert, aber sie endet da, wo Hass beginnt. Und die Pressefreiheit soll dafür sorgen, dass wir überhaupt mitbekommen, wenn etwas schiefläuft.
Die Gewaltenteilung sorgt dafür, dass niemand allein die Macht an sich reißen kann. Und schließlich die Ewigkeitsklausel: Bestimmte Grundprinzipien dieser Verfassung dürfen nie geändert werden. Nicht einmal mit einer Zweidrittelmehrheit. Die Menschenwürde gehört dazu. Auch die Demokratie selbst.
Der Verfassungsschutz ist Teil dieser Architektur. Er soll genau dann eingreifen, wenn Organisationen versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu untergraben. Und ja: Das Grundgesetz erlaubt sogar, Grundrechte einzuschränken – aber nur für diejenigen, die sie missbrauchen, um sie anderen zu nehmen.
Parteien, die verfassungsfeindlich arbeiten, verlieren ihren Anspruch auf staatliche Finanzierung. Ein Parteiverbotsverfahren ist möglich, wenn auch mit großen Hürden verbunden. Gut so. Denn dabei musste abgewogen werden: Wie Verfassungsfeinde von der Macht abhalten? Und wie verhindern, dass Verfassungsfeinde Demokraten mittels dieses Instruments verbieten? Ein Balanceakt. Einer, der die Demokratie schützen soll, nicht die Feinde der gerechten Ordnung.
Letzte Instanz ist das Bundesverfassungsgericht. Hier entscheiden Verfassungsrichter, die das Grundgesetz auslegen.
Für den Fall, dass alles versagt – dass die Demokratie selbst in Gefahr gerät und keine andere Abhilfe mehr möglich ist –, steht da, fast unscheinbar, dieser Satz: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand.“ Artikel 20, Absatz 4.
Diese Sicherheitsarchitektur wurde in den vergangenen Jahren systematisch angegriffen. Vermutlich nicht zufällig. Manche Bereiche wurden umgedeutet. Die öffentlich-rechtlichen Medien wurden so zum „Staatsfunk“ erklärt. Am Tag der Veröffentlichung des Berichts etwa diffamierte der AfDler Rupp in den Tagesthemen den Verfassungsschutz als Geheimdienst in der Tradition der Stasi und Gestapo. Andere wurden verhöhnt: Der Artikel 1 als sentimentales Relikt, das man nicht mehr ernst nehmen müsse. Die Würde nicht allen zugesprochen. Wo das nicht verfing, wurden kurzerhand Menschen als von diesen Rechten ausgeschlossen dargestellt. Würdeloses Auftreten in den Parlamenten, während die parlamentarischen Regeln missachtet werden, um diese lächerlich zu machen. Die Regierungen mit parlamentarischen Anfragen so überzogen, dass sie unter der Arbeitslast dem Tagesgeschäft nicht mehr nachkommen können. Offenes Lügen in Kameras, überforderte und eingeschüchterte Journalist:innen. Wieder andere der Mechanismen wurden absichtlich missverstanden – so oft, bis sich die Bedeutung verschob. Die Meinungsfreiheit etwa, die als Abwehrrecht gegen Extremisten in Amt und Würden gedacht ist, hat rechtliche Grenzen. Aber diese wurden systematisch geleugnet, sie wurde in der letzten Zeit immer wieder als ein Recht dargestellt, alles zu sagen. Auch Morddrohungen, auch Lügen und Würdeverletzungen. Es ist das genaue Gegenteil dessen, was intendiert war und entspricht auch nicht dem Buchstaben des Gesetzes.
Das Grundgesetz: Ein schöner, ein starker Text, der nichts an Aktualität eingebüßt hat. Aber ein Text. So wie die, die ich als Neunzehnjährige gelesen habe. Die Wahrheit kann man nicht aufschreiben, es bleibt nur ein Bild. Und so hat diese große Architektur in den letzten Jahren nicht gereicht, diese Stimmung der Angst, das Anlösen des demokratischen Kerns, zu verhindern.
Nicht die Täter. Die Gesellschaft.
Faschismus ist keine juristische Kategorie. Er ist eine gesellschaftliche Dynamik. Kein Gesetzbuch der Welt kann ihn verhindern. Er wächst in den Köpfen. Drei Viertel Angst, ein Viertel Hass. Dazu: Gier. Bedeutungssucht. Moralische Verwahrlosung. Desinformation. Und der Wunsch, dazuzugehören, ohne nachzudenken.
Das alles erklärt, wie die Rechtsextremisten wieder in unsere Parlamente kamen.
Trotz unserer Geschichte. Trotz unseres Wohlstandes. Trotz des Grundgesetzes.
Wehrhafte Demokratie ist eben nicht nur ein Text. Sie braucht Menschen. Kein Mechanismus wird greifen, wenn niemand ihn auslöst. Die wehrhafte Demokratie ist kein Automatismus mit Garantien. Sie ist eine Architektur, die Menschen mit Leben füllen müssen.
Aber ein Bereich hat funktioniert. Vielleicht läuft diesmal etwas anders. Deshalb schreibe ich wieder mit. Ich hoffe einzufangen, was funktioniert.
Meinung
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Neue Entwicklungspolitik Alabali Radovan: Deutschland gibt Kampf gegen…
- Wahlkampf in Bayern AfD will Einbürgerung nur noch für Reiche –…
- Sachsen Über 600 Kinder ohne Schulplatz – alle ohne deutschen Pass
- „Stoppt die Boote“ Britische Rechtsextremisten jagen Geflüchtete an…
- Minnesota Das Unvorstellbare ist näher, als wir denken
- Bundesagentur Ohne ausländische Beschäftigte geht es nicht mehr