
Du lachst ja gar nicht mehr
Wie Rassismus krank macht
Rassismus ist immer stärker Thema im öffentlichen Diskurs. Im akademischen Kontext steht die Auseinandersetzung jedoch noch am Anfang – auch die Frage, wie Rassismus die Gesundheit beeinflusst.
Von Mahssa Behdjatpour Mittwoch, 19.11.2025, 11:41 Uhr|zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 19.11.2025, 11:41 Uhr Lesedauer: 5 Minuten |
Rassismus wirkt in viele Lebensbereiche hinein: Arbeitsmarkt, Bildungsinstitutionen, Wohnungsmarkt und Gesundheitssystem. Er ist ein gesellschaftliches Problem – mit gesundheitlichen Folgen. Trotz begrenzter Evidenzlage zeigen immer mehr Studien (inzwischen auch aus Deutschland): Wer Rassismus erlebt, hat ein höheres Erkrankungsrisiko und schlechtere Heilungs- und Genesungschancen. Der Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa) verdeutlicht, dass Rassismus die Gesundheit rassistisch markierter Gruppen erheblich beeinträchtigen kann1.
Studien beobachten Zusammenhänge zwischen Rassismus und Erkrankungen wie Asthma, Bluthochdruck, Herz- und Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Übergewicht und Frühgeburten. Rassismus setzt den Körper buchstäblich unter Stress: Wiederholte Diskriminierung kann den Cortisolspiegel erhöhen und Entzündungen sowie Allergien fördern2. Außerdem kann Rassismus ungesunde Bewältigungsstrategien wie Rauchen oder Alkoholkonsum begünstigen3. Auch die mentalen Folgen sind weitreichend: Erlebte Diskriminierung erhöht das Risiko für Depressionen, Angststörungen sowie Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen4. Schützende Ressourcen werden geschwächt, die psychische Verletzlichkeit steigt5.
Umgangsstrategien spielen ebenfalls eine Rolle: Passives Aushalten – also Ignorieren oder Hinnehmen – kann zusätzlich das Wohlbefinden belasten, während aktives Handeln, etwa das Ansprechen von Rassismus und das Suchen von Unterstützung, eher schützt6. Zugleich zeigt die Forschung, wie herausfordernd das Ansprechen rassistischer Erfahrungen ist: Bei der Benennung rassistischer Praktiken und dem Mitteilen persönlicher Diskriminierungserfahrungen wird häufig nicht die Praxis, sondern deren Benennung skandalisiert7. Dieses Abwehrmuster ist als „White Fragility“8 beschrieben: Schon kleine Hinweise auf Rassismus können bei Nicht-Betroffenen Abwehrreaktionen wie Wut, Angst, Schuldgefühle, Streit, Schweigen, Weinen oder Weggehen auslösen.
Ausschluss durch vermeintliche „Objektivität“
„Es gab ein Seminar zu Ableismus und eines zu queerer Gesundheit. Das Wort „Rassismus“ fiel nie.“
Mein Einstieg in die systematische Auseinandersetzung mit dem Thema „Rassismus und Gesundheit“ begann im Public-Health-Studium. Der Schwerpunkt lag auf Gesundheitsförderung und Prävention; Gesundheit wurde definiert als „ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“9. Ziel von Public Health ist folglich nicht nur, Krankheiten zu verhindern oder zu heilen, sondern die Gesundheit aller Bevölkerungsgruppen aktiv zu fördern10. Dazu gehören auch vulnerable Gruppen.
Buchtipp:
Du lachst ja gar nicht mehr: Wie Rassismus krank macht.
von Mahssa Behdjatpour,
erschienen am 10. September 2025 im Rotpunktverlag,
Broschiert,
160 Seiten,
ISBN: 303973069X
Diskriminierungsthemen wurden jedoch kaum thematisiert. Es gab ein Seminar zu Ableismus und eines zu queerer Gesundheit. Das Wort „Rassismus“ fiel nie. Als ich das ansprach, stieß ich auf Widersprüche. Einige Mitstudierende verneinten Rassismus grundsätzlich; zugleich wurde mir als betroffene Person mangelnde „Objektivität“ unterstellt. Meine Perspektive wurde damit ausgeschlossen – ein bequemer Mechanismus, der Deutungshoheit sichert. Das ist Diskursmacht: Privilegierte Gruppen bestimmen, wie Themen diskutiert werden und welche Perspektiven als legitim gelten11.
Weil ich mich in Seminaren nicht äußern konnte, meine Perspektive wiederholt ausgeschlossen wurde und ich im Studium nichts dazu lernte, begann ich meine eigene Recherche: „Welche Rolle spielt Rassismus in der öffentlichen Gesundheit?“ Ich kontrastiere die Frage mit der Forschungslage und meinen Erfahrungen – von der Kindheit im sozialen Brennpunkt bis zur Universität – und zeige, welche Rolle Kunst für Empowerment und Heilung spielen kann.
Wenn Struktur tötet: ein Fallbeispiel
„Patienten und Patientinnen berichten von Misstrauen und dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.“
Rassismus im Gesundheitswesen prägt sowohl die Versorgung als auch die Inanspruchnahme von Leistungen12. Patienten und Patientinnen berichten von Misstrauen und dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Folgen können Fehldiagnosen oder unpassende Therapien sein13. Sichtbar wird dies u. a. in der Pseudodiagnose „Morbus Mediterraneus“: Beschwerden und starke Schmerzen von Patienten und Patientinnen mit zugeschriebener „südländischer“ Herkunft werden als „Überempfindlichkeit“ abgetan.
Diese Pseudodiagnose war mir bereits aus der Krankheitsgeschichte meines Vaters bekannt.
„Der jahrelang verschiedene Ärzt:innen aufsuchte, weil er Schmerzen hatte, dem als Diagnose psychische Beschwerden aufgrund von ‚Heimweh‘ und ‚Wehleidigkeit‘ diagnostiziert wurden, während sich die Krebszellen unkontrolliert vermehrten, einen Tumor in der Niere bildeten und genug Zeit hatten, um zu streuen.“14
Weil trotz Beschwerden über Jahre hinweg keine Untersuchungen stattfanden – nicht einmal ein Bluttest, der den Krebs hätte entdecken können –, blieb eine Früherkennung aus. Das hat möglicherweise zum tödlichen Verlauf beigetragen.
„Rassismus tötet. Manchmal direkt, wie bei den Anschlägen in Hanau oder Halle (Saale) … und manchmal indirekt und institutionell, wie bei meinem Vater.“15
Wer „Gesundheit für alle“ ernst meint, muss Rassismus als Gesundheitsdeterminante anerkennen und konsequent handeln: benennen, erfassen, verändern – in Lehre, Forschung und Versorgung, gemeinsam mit den Betroffenen.
Quellen
- Acheson, D. (1988). Public health in England: Report of the Committee of Inquiry into the future development of the public health function. London: HMSO.
- Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). (2023). Rassismus und seine Symptome: Bericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa). Berlin: DeZIM-Institut.
- DiAngelo, R. (2016). White fragility. Counterpoints, 497, 245–253.
- Kajikhina, K., Koschollek, C., Bozorgmehr, K., Sarma, N., & Hövener, C. (2023). Racism and discrimination in the context of health inequalities: A narrative review. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 66, 1099–1108.
- Maeße, J. (2017). Deutungshoheit: Wie Wirtschaftsexperten Diskursmacht herstellen. In J. Hamann, J. Maeße, V. Gengnagel & A. Hirschfeld (Hrsg.), Macht in Wissenschaft und Gesellschaft: Diskurs- und feldanalytische Perspektiven (S. 291–318). Wiesbaden: Springer VS.
- Messerschmidt, A. (2010). Distanzierungsmuster: Vier Praktiken im Umgang mit Rassismus. In Rassismus bildet (S. 41–58).
- Razum, O., & Wenner, J. (2016). Social and health epidemiology of immigrants in Germany: Past, present and future. Public Health Reviews, 37, 4.
- World Health Organization. (1978). International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata. HFA Leadership/M2.
- DeZIM, 2023
- Kajikhina et al. 2023, S. 1104
- Ziegler & Beelmann 2015; Kajikhina et al. 2023
- Ziegler & Beelmann 2015, S. 364 ff.; Razum & Wenner 2016: 7
- Kajikhina et al. 2023, S. 1104
- Kajikhina et al. 2023, S. 1104
- Messerschmidt 2010, S. 42
- DiAngelo 2016, S. 246
- WHO 1978
- Acheson 1988, S. 1
- Maeße 2017, S. 291 f.
- Kajikhina 2023, S. 1103
- Kajikhina 2023, S. 1103
- „Du lachst ja gar nicht mehr“ S. 114
- „Du lachst ja gar nicht mehr“ S. 116
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Berlin-Monitor Jeder Dritte fühlt sich von Muslimen bedroht
- Das Repressionskarussell Erst gegen Geflüchtete – dann gegen alle
- „Perfide Menschenjagd“ CDU-Minister fordert Handyortung und Observation von…
- Keine Behörde ohne Rassismus Ataman: Innenminister Dobrindt ignoriert eigene…
- Beschwichtigung? Innenministerium: Orientierung statt Integration
- Flüchtlingspolitik Athen und Berlin planen Abschiebelager in Afrika

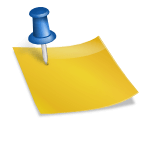

Dieser Artikel ist leider nicht objektiv-neutral in der Auswertung der vorhandenen Literatur zum Rassismus, der sogenannten Rassismuskritik, noch stellt sie die tatsächlich vorhandenen Arbeiten gegen Rassismus ins richtige Licht, denn in den vorhandenen Studiengängen zur Rassismuskritik an deutschen Fachhochschulen, wie in der FH Bielefeld als Bereich des Sozialwesens, des Gesundheits- und Sozialer Arbeit Bereichs, und in den Universitäten, wie in der Universität Bielefeld und zwischen den ProfessorInnen dieser fachlichen Richtung, finden sehr interessante und fundierte Diskussionen und Arbeiten über Rassismus statt. Und die Autorin zitiert, meiner Meinung nach, auch zu ungenau, so dass ein anderer Eindruck entsteht, als der den die tatsächliche Bedeutung der Fachbegriffe hat, wie z. B. bei „White Fragility“. Das ist schade, weil nicht klar benannte Fakten zu Beeinträchtigungen in der Deutlichkeit und Verständlichkeit führen können.
Meines Erachtens haben Sie den Inhalt des Artikels lediglich bestätigt. Wie dort beschrieben, ist die Forschungslage an vielen Universitäten und Hochschulen nach wie vor dünn. Es wurde außerdem erwähnt, dass das Thema an der Hochschule bislang noch nicht präsent war und Erfahrungen daher mit der bestehenden Forschung kontrastiert wurden.
Hier auch noch ein weiterer Artikel, in dem deutlich wird, dass die Rassismusforschung große Lücken aufweist:
https://www.migazin.de/2025/12/01/grosse-luecke-deutschland-vernachlaessigt-rassismusforschung/