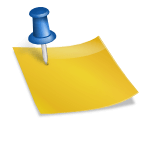Appell
Auf Willkommenskanzlerin folgten zwei Abschiebekanzler
Zehn Jahre nach „Wir schaffen das“ dominiert nicht mehr Empathie, sondern Abschreckung. Der Diskurs ist gekippt. Die Folgen für Geflüchtete wirken bis heute – und sitzen tief.
Von Dženeta Isaković Sonntag, 09.11.2025, 10:24 Uhr|zuletzt aktualisiert: Sonntag, 09.11.2025, 10:36 Uhr Lesedauer: 7 Minuten |
Im Jahr 2015 suchten etwa 890.000 Menschen Schutz in Deutschland. Die meisten kamen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde für ihren Ausspruch „Wir schaffen das“, mit dem sie Bereitschaft und Menschlichkeit signalisierte, diese Schutzsuchenden aufzunehmen, weltweit bekannt und vielfach geschätzt. Doch von Beginn an gefährdeten Planungsschwierigkeiten, Überforderungen der Kommunen sowie rassistische Haltungen bei Teilen politischer Vertreter:innen und innerhalb der Aufnahmegesellschaft diese Willkommenskultur.
Schon früh wurden problemzentrierte und destruktive Debatten geführt. Es entstand der Begriff „Flüchtlingskrise“, und das Thema Flucht wurde eng mit Islam, Extremismus und Terrorismus verknüpft. Nicht selten wurde alles gleichzeitig verhandelt, ungeachtet dessen, dass geflüchtete Menschen nicht immer muslimisch waren, die allerwenigsten Muslime extremistisch waren und viele Geflüchteten selbst wegen Terrorismus und Diskriminierung ihre Heimat verlassen mussten.
Umgekehrt blieben Berichte über Schutzsuchende, die Opfer rassistischer und rechtsextremer Gewalt wurden, medial meist Randnotizen. Dabei verzeichnete das Bundeskriminalamt allein im Jahr 2016 mehr als 3.500 Straftaten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Geflüchtete, darunter fiel auch Hasskriminalität in Erscheinung von Körperverletzungen, versuchten Tötungen und Angriffen auf Asylunterkünfte.
Von Willkommenskultur zum „Problem im Stadtbild“
Zehn Jahre später hat sich der Diskurs deutlich verschärft. Die Bundesregierung betreibt keine Willkommenspolitik mehr, sondern eine Migrationspolitik der Abschreckung, begleitet von einer zunehmend ablehnenden und rassistischen Rhetorik. Auf die „Willkommenskanzlerin“ folgten zwei „Abschiebekanzler“, welche gerne auf das alte Narrativ vom Zusammenhang zwischen Islam, Flucht und Terrorismus zurückgreifen, obwohl die Terrorismusforschung keine Belege dafür liefert.
Friedrich Merz äußert öffentlich mehrfach in Live-Interviews seinen Missmut und sein persönlich empfundenes Störgefühl, wenn er vermeintlich migrantische, illegal in Deutschland lebende, arbeitslose junge Männer im weißen Stadtbild erblickt, ganz so, als könne man Aufenthalts- oder Erwerbstätigkeitsstatus am äußeren Erscheinungsbild von Menschen ablesen.
„Auch meine Eltern mahnten uns Kinder an, niemandem zu erzählen, dass wir geflüchtet waren.“
Viele dieser Entwicklungen erinnern mich an meine eigene Kindheit in den 1990er Jahren: Auch meine Familie und ich waren Schutzsuchende. Wir lebten fast zehn Jahre lang mit Duldung, durften Deutschland nicht verlassen und brauchten Genehmigungen, um das Bundesland zu verlassen. Die großen blau-rot karierten „Asylantentaschen“, wie wir sie nannten, standen vorsorglich gepackt bereit. Wir bekamen keine staatliche Unterstützung, es gab keine kostenlosen Sprachkurse für Geflüchtete. Ich war sieben, als ich die Abschiebung eines Bekannten mitansehen musste – in Handschellen abgeführt, ohne sich vorher waschen zu dürfen, als sei er ein Verbrecher.
Damals wie heute wurde das Wort „Flüchtling“ oft als herabwürdigende Beleidigung gebraucht. Viele Menschen mit Fluchterfahrung verbergen diesen Teil ihrer Biografie, wenn sie sich auf eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle bewerben, um den damit verbundenen Stigmatisierungen zu entkommen. Auch meine Eltern mahnten uns Kinder an, niemandem zu erzählen, dass wir geflüchtet waren.
Rassistische Narrative – und ihre Folgen
Rassistische und menschenfeindliche Bilder über asylsuchende Menschen durchziehen alle Lebensbereiche von Schule und Arbeitswelt bis in Politik und Medien und bleiben häufig unwidersprochen. Die Mitte-Studie, amtliche Zahlen sowie die Erfahrungen aus unserer Antidiskriminierungsberatung, belegt das eindrücklich. Heute werden Geflüchtete sogar gegeneinander ausgespielt, in „echte“ und „unechte“, „nette“ und „gefährliche“, „integrierbare“ und „nicht integrierbare“.
„Rassistische und menschenfeindliche Bilder über asylsuchende Menschen durchziehen alle Lebensbereiche von Schule und Arbeitswelt bis in Politik und Medien und bleiben häufig unwidersprochen.“
In meiner Arbeit als politische Bildnerin erlebe ich immer wieder, wie tief diese Narrative wirken. In einem Seminar empörte sich eine Opferschützerin darüber, dass ein Geflüchteter bei der Opferberatung den Handschlag verweigerte und vollzog dabei rasch eine Täter-Opfer-Umkehr, bei der ein vergewaltigter junger Ratsuchender, zum vermeintlich „nicht integrierbaren, sexistischen Täter“ gemacht wurde.
In einem anderen Fall wurde für eine Willkommensklasse ein Workshop zur Extremismusprävention angesetzt, nachdem ein geflüchteter Schüler vom Ausbildungsbetrieb ausgeschlossen worden war. Ausschlaggebend war sein Mittagsgebet während der Pause, das als „islamistisch“ wahrgenommen wurde, obwohl seine zuvor von Lehrkräften und Auszubildenden anerkannte Arbeitsmoral und Sozialkompetenz bis dahin als vorbildlich galten.
In einer gemischten Schulklasse erlebte ich, wie eine kleine Gruppe junger Mädchen unaufhörlich Stereotype über geflüchtete Jungen und junge Männer verbreitete, während zugleich geflüchtete Jungen in der Klasse saßen, für die niemand aus der Klassengemeinschaft eintrat. Die Schulleitung war nicht bereit, Konsequenzen folgen zu lassen, da die Mädchen „aus gutem Hause“ kämen und leistungsstarke Schülerinnen seien.
„Selbst in Willkommensklassen zeigt sich, wie tief rassistische Hierarchien wirken.“
Pädagog:innen und Sozialarbeiter:innen berichteten mir in Fortbildungen und Netzwerktreffen mehrfach, dass in den Willkommensklassen ihrer Schulen als weiß wahrgenommene Geflüchtete und Migrant:innen BPoC-Geflüchtete rassistisch beleidigten, weil sie aus dem Verhalten der Lehrkräfte und aus Medien entnähmen, dass „die Anderen“ in Deutschland weniger willkommen seien und sie selbst die „besseren Migrant:innen“ seien.
Selbst in Willkommensklassen zeigt sich, wie tief rassistische Hierarchien wirken. Pädagog:innen und Sozialarbeiter:innen berichteten mir in Fortbildungen und Netzwerktreffen, dass sie beobachten wie weiß gelesene Geflüchtete BPoC-Geflüchtete beleidigen, weil sie gelernt haben, dass „die Anderen“ weniger willkommen seien.
Populistische Spaltung und fehlende Empathie
Ich lese und sehe gefühlt täglich in den Medien, wie einige populistische Politiker:innen bewusst versuchen, eine spalterische Neiddebatte loszutreten, mit dem Ziel, der Bevölkerung zu vermitteln, ihr würde etwas von „arbeitsverweigernden Migranten“ weggenommen, die für angebliche „Untätigkeit belohnt“ würden. Einen Höhepunkt stellte die Politsendung dar, in der der Millionär Friedrich Merz behauptete, abgelehnte Asylbewerber ließen sich beim Arzt kostenlos die Zähne richten, während deutsche Bürger daneben keine Termine bekämen. Ganz zu schweigen vom ständigen Vorwurf des „importierten Antisemitismus“ gegen Migrant:innen: als gäbe es keine tausendjährige deutsch-europäische Geschichte des Antisemitismus.
Flucht als dauerhafte Wunde
Was eine Flucht bedeutet, scheint vielen Menschen bis heute schwer verständlich: der Verlust von Heimat, Familie und Sicherheit, das Überleben auf lebensgefährlichen Wegen – oft ohne Gewissheit, jemals anzukommen. Laut Schätzungen von UNICEF, der EU-Grundrechteagentur und Sea-Watch starben allein 2024 über 2.000 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Seit 2014 gelten über 30 000 Menschen als tot oder vermisst.
Flucht hinterlässt tiefe seelische Spuren: Identitätskrisen, Entwurzelung, Depressionen. Viele meiner Bekannten, die seit 2015 aus Syrien, Somalia, Afghanistan oder dem Irak geflohen sind, berichten von traumatischen Erlebnissen – vom Verlust geliebter Menschen, von Gewalt, Hunger, Missbrauch, von der Enttäuschung über die Kälte mancher Nachbarschaften in Deutschland. Vertrauen zu fassen fällt schwer, wenn einem Misstrauen entgegenschlägt.
Die Syrian American Medical Society prägte 2018 den Begriff „Human Devastation Syndrome“ – das Syndrom der menschlichen Zerstörung. Es beschreibt seelische Zustände, die über klassische Traumafolgen hinausgehen: tiefe Erschöpfung, anhaltende Angst, schwere Depressionen, psychosomatische Beschwerden, Verlust des Lebenssinns. Viele syrische Geflüchtete in meinem Bekanntenkreis erkennen sich darin wieder.
Können wir als Gesellschaft wirklich erwarten, dass diese Menschen kurzerhand ihre Erlebnisse, Krankheiten und Krisen überwinden, die Sprache zügig erwerben, dem Arbeitsmarkt schnell zur Verfügung stehen und Glaube sowie Traditionen einfach beiseiteschieben? Können wir von Geflüchteten eine rasche Rückkehr in einen „normalen“ Alltag erwarten? Oder müssen wir vielmehr davon ausgehen, dass es für viele Geflüchtete nach diesen Erfahrungen nie wieder eine Normalität geben kann?
Der junge syrische Dichter Abdalrahman Alqalaq drückt es in Flüchtlinge und ihre Schatten folgendermaßen aus:
Und wenn ihnen Angst durch die Zähne dringt
bauen sie tief drin wacklige Stützen
und nennen es ihr neues Leben
Andere wieder haben einen großen Schatten,
aber keinen Körper
Sie sind ein Schatten
auf der Erde
und alle treten darauf.
Ein Appell für Empathie und Verantwortung
Zehn Jahre nach dem „Sommer der Migration“ sollten wir als Gesellschaft innehalten. Fachkräfte in Pädagogik, Sozialarbeit, Medizin und Therapie brauchen mehr Wissen über Flucht und ihre Folgen. Politik und Kommunen sollten Geflüchtete nicht als Belastung sehen, sondern als Bereicherung, nicht zuletzt, weil die alternde deutsche Gesellschaft sie dringend braucht.
Vor allem aber benötigen Geflüchtete Zeit, Verständnis und Unterstützung, um ihre Traumata zu verarbeiten. Unsere Empathie ist kein Luxus – sie ist Grundvoraussetzung für Identifikation und Bindung von Migrant:innen an unsere Gesellschaft. Nur so ein gutes Zusammenleben gelingen.
MeinungInfo: Dieser Beitrag ist eine Kooperation von MiGAZIN mit dem Netzwerk Rassismuskritische Migrationspädagogik Baden-Württemberg, das unter dem Dach von adis e.V. Antidiskriminierung – Empowerment -Praxisentwicklung organsiert ist. Das Netzwerk versteht sich als Forum von Menschen aus den Feldern Soziale Arbeit, Schule, Bildung/Weiterbildung, Hochschule sowie angrenzenden Professionen, die sich fachlich und (fach-)politisch in den Feldern Soziale Arbeit, Schule, Weiterbildung – und auch darüber hinaus – einmischen und dort Rassismus selbststärkend, reflexiv-kritisch und wenn nötig auch skandalisierend zum Thema machen. Das Netzwerk informiert Interessierte in regelmäßigen Abständen von circa zwei Monaten per E-Mail-Newsletter über aktuelle Entwicklungen, Veranstaltungen und Publikationen im Feld der Migrationspädagogik.
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- „Dramatische Situation“ Grüne: Dobrindt sabotiert Integrationskurse
- CDU fordert Abschiebung Geflüchteter reißt sich und 18-jährige Iranerin in den Tod
- Sachsen-Anhalt Asylzahlen auf Rekord-Tief, AfD auf Rekord-Hoch
- Ärzte ohne Grenzen Deutschland blockiert Visa zur Behandlung verletzter…
- Oberverwaltungsgericht NRW Einreiseverbot mit Einbürgerung in den Niederlanden…
- EU-Asylpolitik Schwarz-Rot einigt sich auf maximale Strenge