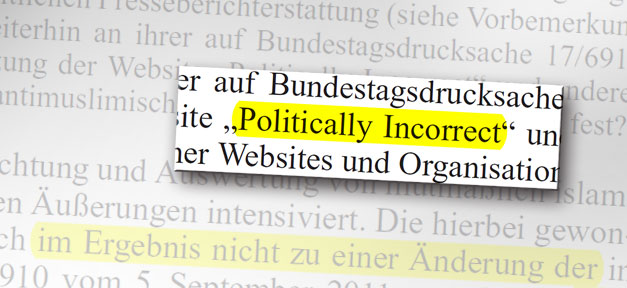Rote Linie
Die AfD muss verboten werden
Was darf eine Demokratie aushalten? Ein AfD-Verbot ist keine Symbolpolitik – es ist verfassungsrechtlicher Selbstschutz. Doch ein Urteil allein reicht nicht. Warum die rote Linie gezogen werden muss – und was danach kommt.
Von Nasim Ebert-Nabavi Donnerstag, 04.09.2025, 10:22 Uhr|zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 04.09.2025, 10:11 Uhr Lesedauer: 5 Minuten |
Lange schien das eine theoretische Frage für Talkshows und Sonntagsreden. Seit der Verfassungsschutz die AfD als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft hat, ist sie zum Prüfstein geworden. Plötzlich steht im Raum, ob das Grundgesetz zu seiner schärfsten Waffe greift: dem Verbot einer Partei.
In der Bundesrepublik wurde das nur zweimal erfolgreich angewandt – gegen die SRP (1952) und die KPD (1956). Seither hat das Bundesverfassungsgericht die Hürden so hoch gelegt, dass Parteiverbote zur Ausnahme wurden. Aber was, wenn aus der Ausnahme eine Notwendigkeit wird?
Ein Gutachten mit Sprengkraft
Das Hochstufungs-Gutachten des Verfassungsschutzes ist kein gewöhnliches Papier. Es listet Seite um Seite Äußerungen und Forderungen, die weit über polemische Zuspitzung hinausgehen: „Remigration“, also die Abschiebung bis hin zu Eingebürgerten. „Passdeutsche“, die rhetorische Abwertung von Staatsbürger:innen mit Migrationsgeschichte. Immer wieder der ethnisch verstandene Volksbegriff, der Menschenwürde und Gleichheit vor dem Gesetz relativiert.
„Es sind kalkulierte Kampfbegriffe, mit denen die AfD die Grundpfeiler der Verfassung angreift.“
Das sind keine sprachlichen Ausrutscher. Es sind kalkulierte Kampfbegriffe, mit denen die AfD die Grundpfeiler der Verfassung angreift. Wer das ernst nimmt, erkennt: Hier geht es nicht mehr um scharfe Debatte, sondern um den Angriff auf die Substanz der Demokratie.
Juristisch ist entscheidend: Die Unterschiede zwischen der sicherheitsbehördlichen Einstufung „gesichert rechtsextrem“ und den Maßstäben für ein Parteiverbot sind kleiner, als oft behauptet. Beide setzen voraus, dass eine Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist. Für ein Verbot verlangt Karlsruhe zusätzlich den Nachweis eines planvollen Hinarbeitens auf deren Beseitigung. Genau dafür liefert das Gutachten zahlreiche Anhaltspunkte – nicht als Sammlung geschmackloser Zitate, sondern als konsistentes Muster, unvereinbar mit den Grundprinzipien des Grundgesetzes.
Lehren aus der Vergangenheit
2017 scheiterte das zweite NPD-Verbotsverfahren. Das Bundesverfassungsgericht stellte zwar die Verfassungsfeindlichkeit fest, verweigerte aber das Verbot: der Partei fehle das politische Potenzial zur Umsetzung ihrer Ziele.
Genau hier liegt der Unterschied zur AfD. Sie ist keine Splitterpartei, sondern in Teilen des Landes stärkste Kraft, bundesweit stabil zweistellig. Das Argument der Bedeutungslosigkeit greift nicht. Wer nur beobachtet, aber nicht handelt, verkennt den Unterschied zwischen einer Randpartei und einer Bewegung, die Diskurse von innen verschiebt.
Die schärfste – und gefährlichste – Waffe
„Ein Parteiverbot ist die schärfste Waffe der Demokratie – und ihre gefährlichste.“
Ein Parteiverbot ist die schärfste Waffe der Demokratie – und zugleich ihre gefährlichste. Wer vorschnell nach Karlsruhe zieht, riskiert mehr als eine juristische Niederlage. Die AfD könnte sich als Opfer inszenieren. Und wenn die Wehrhaftigkeit im entscheidenden Moment versagt, beschädigt das die Demokratie selbst.
Deshalb darf ein Verbotsverfahren nicht überhastet kommen, sondern muss sorgfältig vorbereitet werden. Aber auch das Zögern ist riskant: Wenn eine Demokratie ihre Schutzmechanismen nicht nutzt, obwohl sie könnte, signalisiert sie Schwäche.
Vorbereitung ist Pflicht – nicht Option
Das Verfassungsschutz-Gutachten ist eine wesentliche Grundlage. Die Entscheidung über ein Verbot liegt zwar allein beim Bundesverfassungsgericht. Doch zuvor klären die Verwaltungsgerichte, ob die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ rechtmäßig ist. Bestätigen sie – etwa das OVG Münster –, wird der Boden bereitet. Dann lässt sich das Material nicht länger relativieren, sondern in Karlsruhe als tragfähige Basis nutzen.
Dafür braucht es Vorarbeit: Belege sichten, Schriftsätze entwerfen, Argumentationslinien ordnen. Wer wartet, bis sich das Fenster öffnet, und dann erst beginnt, verspielt wertvolle Zeit.
Ein Verbot löst nicht alles – aber es zieht eine Grenze
„Ja, ein Verbot ist geboten. Aber es wird das Problem allein nicht lösen.“
Ja, ein Verbot ist geboten. Aber es wird das Problem allein nicht lösen. Ein Urteil kann eine Partei aus Parlamenten entfernen. Es beseitigt nicht das Gedankengut, das sie trägt. Eine Gesinnung lässt sich nicht verbieten; sie lebt in Einstellungen, Netzwerken und gesellschaftlichen Rissen.
Gerade deshalb wächst mit einem Verbot die Verantwortung der demokratischen Parteien. Sie müssen Antworten geben auf jene Fragen, die Populist:innen so erfolgreich ausschlachten: soziale Ungleichheit, Abstiegsängste, Migration, die Sorge vor Kontrollverlust in einer komplexen Welt. Wer diese Themen ignoriert oder mit Schlagworten abtut, überlässt das Feld denen, die „einfache“ Lösungen mit gefährlicher Wirkungskraft anbieten.
Die rote Linie – und die tägliche Arbeit
„Ein AfD-Verbot ist kein politisches Manöver, sondern ein Akt verfassungsrechtlicher Selbstverteidigung.“
Ein AfD-Verbot ist kein politisches Manöver, sondern ein Akt verfassungsrechtlicher Selbstverteidigung: ein Schutzmechanismus, den das Grundgesetz bewusst vorgesehen hat. Es markiert die rote Linie: Die Demokratie darf nicht als Bühne für ihre Feinde missbraucht werden. Aber dieses Signal allein reicht nicht. Ein Urteil aus Karlsruhe wird den Hass nicht verschwinden lassen.
Es braucht mehr – politischen Mut, klare Sprache, gesellschaftliche Gestaltungskraft. Vor allem braucht es die Bereitschaft, Demokratie im Alltag spürbar zu machen: in Schulen, Parlamenten, Kommunen, Betrieben. Das Grundgesetz ist kein bloßes Versprechen. Es schützt nicht nur. Es verpflichtet.
Ein Verbot ist der Anfang, nicht das Ende. Die rote Linie muss sichtbar, klar, unmissverständlich gezogen werden. Ob das Signal trägt, entscheidet sich nicht allein in Karlsruhe. Es entscheidet sich in der Politik und in den Klassenzimmern, in Betrieben und Nachbarschaften – überall dort, wo Menschen täglich zusammenleben.
„Am Ende geht es um mehr als eine juristische Entscheidung. Es geht um die Gesellschaft, die wir sein wollen.“
Denn am Ende geht es um mehr als eine juristische Entscheidung. Es geht um die Gesellschaft, die wir sein wollen: eine, in der Hass und Hetze Alltag werden und die Sprache der Ausgrenzung zur Normalität – oder eine, die auf Respekt, Vielfalt und Menschenwürde baut und genau darin ihre Stärke findet.
Ein Verbot der AfD kann und muss das klare Signal senden, dass die Demokratie ihre Feinde nicht gewähren lässt. Doch „Nie wieder“ ist kein Versprechen an die Vergangenheit, sondern eine Pflicht in der Gegenwart. Meinung
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Klimaklage aus Pakistan Deutschland mitverantwortlich für Jahrhundertflut?
- Sachsen Über 600 Kinder ohne Schulplatz – alle ohne deutschen Pass
- Neue Entwicklungspolitik Alabali Radovan: Deutschland gibt Kampf gegen…
- Wahlkampf in Bayern AfD will Einbürgerung nur noch für Reiche –…
- Return Hubs EU-Staaten bereiten Abschiebezentren in Drittstaaten vor
- Wirbel um OB-Kandidaten „Mein N-Wort ist Nürnberg“