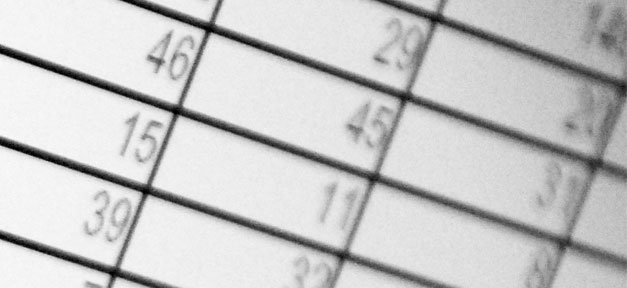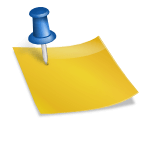20 Jahre Migrations-Museum
Auswandererhaus hält Überfremdungsängsten Fakten entgegen
Sieben Millionen Menschen sind seit 1830 über Bremerhaven nach Amerika ausgewandert. Das Deutsche Auswandererhaus greift viele Facetten der Migration auf. Für manchen wird der Museums-Besuch zur emotionalen Reise. Manche haben Gelegenheit zur Reflexion zu aktuell brisanten Themen.
Von Dieter Sell Donnerstag, 07.08.2025, 12:41 Uhr|zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 07.08.2025, 12:41 Uhr Lesedauer: 4 Minuten |
Eine düstere Hafenszene, ein kühler Novembermorgen im Jahr 1888: Am Anlegeplatz in Bremerhaven ragt mächtig die Bordwand des Schnelldampfers „Lahn“ auf, ein Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd. In acht bis zehn Tagen bringt der Dampfer Auswanderer in die „Neue Welt“ nach New York. Auf der Pier türmen sich die Koffer, ein Gewirr unterschiedlicher Stimmen und Sprachen schwirrt durch die Luft. Überall stehen Männer, Frauen und Kinder, die auf die Abreise warten – den Kopf und das Herz voller Hoffnungen, Sehnsüchte, Sorgen, Ängste und Wehmut.
Die Menschen in der schummrigen Atmosphäre sind lebensgroße Puppen in historischen Kostümen, die Schiffswand der „Lahn“ ist nachgebaut, die Stimmen kommen aus versteckten Lautsprechern. Sie sind Teil einer Kulisse, mit der das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven seine Besucherinnen und Besucher empfängt.
„Das ist extrem beeindruckend, vor dieser Schiffswand zu stehen, auch beängstigend“, sagt Matthias Schmidt aus Worpswede bei Bremen, der zum ersten Mal das Museum besucht. „An diesem Ort kann ich nachfühlen, was wohl in den Menschen vorgegangen sein muss, die sich auf die Reise in eine fremde Welt begeben haben.“ Vor 20 Jahren, am 8. August 2005, wurde das Museum eröffnet.
Brisante Themen im Haus
Das Warten kurz vor der Abreise, das sei „ein bittersüßer Moment“ gewesen, so beschreibt es Simone Blaschka, Direktorin des Auswandererhauses. Das Museum steht an einem historischen Ort: Von Bremerhaven aus brachen zwischen 1830 und 1974 mehr als sieben Millionen Menschen aus Mittel- und Osteuropa auf, oft als Wirtschaftsflüchtlinge oder weil sie politisch oder religiös verfolgt wurden. Die Seestadt an der Weser wurde so zum größten kontinentaleuropäischen Auswandererhafen. Meist ging es in die Vereinigten Staaten oder nach Südamerika, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen.
„Wanderungsbewegungen sind so alt wie die Geschichte der Menschheit“, sagte beim Festakt zur Eröffnung des Museums am 8. August 2005 der damalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD). Zwei Erweiterungsbauten zur Einwanderungsgeschichte nach Deutschland sind seitdem entstanden. Von Anbeginn greift das Haus auch brisante Fragen auf.
Fakten gegen Überfremdungsängste
Überfremdungsängsten stellt das Museum in Präsentation und Forschung Fakten und Aufklärung entgegen. Das sei angesichts der rechtsradikalen Positionen zum Thema Migration, die in den Bundestag eingezogen seien, noch dringender geworden, betont Museumsdirektorin Blaschka. Sie warnt vor einer durch Hetze, Rassismus und Antisemitismus aufgeladenen politischen Situation. „Der Ernst und die Gefahren dieser Lage werden aus meiner Sicht im Moment nicht genug gewürdigt“.
Bis heute folgten nach ihren Angaben rund 3,4 Millionen Besucherinnen und Besucher dem Rundgang im Migrations-Museum. Um Inhalte authentisch vermitteln zu können, legt das knapp 60-köpfige Museumsteam in Bremerhaven besonderen Wert auf das persönliche Schicksal der Menschen, die aus- und eingewandert sind. So schlüpfen Besucherinnen und Besucher mit ihrer Eintrittskarte, ihrem „Boarding Pass“, in eine von 18 Auswandererbiografien.
„Das nimmt einem den Atem.“
An Hörstationen, in Dokumenten und Infotexten werden Hintergründe und persönliche Motive der Auswanderung vermittelt – ein Konzept, für das das Haus 2007 als Europas „Museum des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Multimediastationen, persönliche Erinnerungsstücke und Möglichkeiten, in Datenbanken die Geschichte eigener ausgewanderter Vorfahren zu recherchieren, ergänzen den Besuch. Vor allem aber lebt er durch die Inszenierung historischer Räume.
Rekonstruierte Schlafkojen lassen spürbar werden, in welcher Enge die Auswandernden unter Deck die Schiffspassage verbrachten. „Das nimmt einem förmlich den Atem“, beschreibt es Besucher Matthias Schmidt. Auf seinem Weg durch das Museum verfolgt er die Biografie von Erich Koch-Weser (1875–1944), der 1933 vor den Nazis geflohen und nach Brasilien ausgewandert ist. Er war zuvor Bürgermeister von Delmenhorst, Bremerhaven und Kassel sowie Minister und Vizekanzler in der Weimarer Republik.
Anregung zur Reflexion
Seine Biografie werde einfühlsam und ohne Belehrung vermittelt, sagt Schmidt: „Das hat mir die Augen für sein Schicksal geöffnet.“ Hinzu kommen die beklemmende Rekonstruktion der US-amerikanischen Einwanderungsstation auf Ellis Island, eine Kulisse der New Yorker Grand-Central-Station und Modelle exemplarischer Lebenswelten Ausgewanderter wie ein „Deli“-Imbiss.
Im „Saal der Debatten“ und an digitalen „Critical Thinking Stations“ können sich Interessierte mit aktuellen gesellschaftlichen Kontroversen rund um Migration und Asylrecht auseinandersetzen. Ziel ist es, die Besucher zur eigenen Reflexion anzuregen. Es sind aber vor allem die Inszenierungen, die am Ende Matthias Schmidt begeistern. „Man taucht tief in die Welt der Menschen ein, die ausgewandert sind“, sagt er. „Und geht dabei selber auf eine große, emotionale Reise.“ (epd/mig) Aktuell Feuilleton
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- „Dramatische Situation“ Grüne: Dobrindt sabotiert Integrationskurse
- CDU fordert Abschiebung Geflüchteter reißt sich und 18-jährige Iranerin in den Tod
- Widerrufsprüfungen von Geflüchteten: 93 Prozent…
- Sachsen-Anhalt Asylzahlen auf Rekord-Tief, AfD auf Rekord-Hoch
- Ärzte ohne Grenzen Deutschland blockiert Visa zur Behandlung verletzter…
- Oberverwaltungsgericht NRW Einreiseverbot mit Einbürgerung in den Niederlanden…