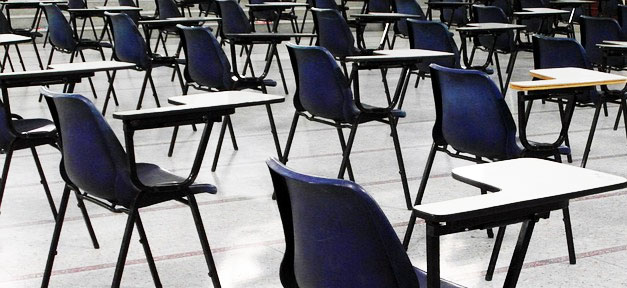Daniel Terzenbach im Gespräch
Willkommensgefühl zentral für Fachkräfteeinwanderung
Daniel Terzenbach ist Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit und war als Sonderbeauftragter der vorherigen Bundesregierung maßgeblich mitzuständig für den „Job-Turbo“, um Geflüchtete in Arbeit zu bringen. Im Gespräch erklärt er die Schwierigkeiten und Erfolge des Programms, Herausforderungen beim Fachkräftezuzug und die aufgeheizte Bürgergeld-Debatte.
Von Christina Neuhaus Dienstag, 18.11.2025, 11:50 Uhr|zuletzt aktualisiert: Dienstag, 18.11.2025, 11:50 Uhr Lesedauer: 6 Minuten |
Bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt ist mit dem Programm „Job-Turbo“ viel erreicht worden, wie mehrere Studien zeigen. Was waren die Hauptfaktoren, die das möglich gemacht haben?
Daniel Terzenbach: Ein Faktor war die höhere Kontaktdichte, also dass wir enger und verbindlicher mit den Menschen zusammengearbeitet haben. Das war natürlich eine besondere Herausforderung für die Jobcenter, aber es hat sich gezeigt, dass wir mit diesem gemeinsamen Kraftakt nachweislich mehr erreicht haben. Außerdem gab es eine deutlich engere Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden und Migrationsverbänden, also den Communitys der Geflüchteten, und im Falle der Geflüchteten aus der Ukraine auch mit der ukrainischen Botschaft. Es klappt am besten, wenn all diese Beratungsleistungen aus einem Guss sind und die Menschen nicht hier das eine hören und dort etwas anderes. Ein dritter Punkt war schlicht, Klinken zu putzen und die Chancen für die Unternehmen aufzuzeigen, die geflüchtete Menschen mitbringen. Gerade mit kleinen und mittleren Firmen haben wir intensiv besprochen, welche Unterstützung nötig ist, wenn eine geflüchtete Person eingestellt wird.
Beim „Job-Turbo“ ging es ja vor allem um Menschen aus der Ukraine und einigen anderen Herkunftsländern. Müsste der angesprochene „Kraftakt“ nicht für alle Geflüchteten wiederholt werden?
Am Anfang haben wir sehr viel Arbeit investiert, um entsprechende Strukturen aufzubauen, aber der Aufwand wird natürlich im laufenden Geschäft irgendwann weniger. Im Grunde geht der „Job-Turbo“ ins operative Geschäft über. Die intensive Betreuung findet immer noch statt und die Integration in den Arbeitsmarkt gegenüber den Vorjahren nimmt immer noch weiter leicht zu – und das trotz durchweg schlechter Konjunktur. Das zeigt, dass der Weg nachhaltig ist.
Allerdings läuft die Arbeitsmarktintegration bei geflüchteten Männern sehr viel besser als bei den Frauen – warum?
Es geht vor allem um drei Dimensionen. Zum einen müssen die Arbeitsverwaltungen selbst mehr machen, zum Beispiel mehr in Sprachförderungen und spezifische Coachings investieren. Häufig müssen wir auch die Kinderbetreuung mitorganisieren, das geht aber auch nur gemeinsam mit den Kommunen. Dann ist es aber auch so, dass wir über die Rolle der Frau sprechen müssen. In Deutschland wollen wir die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, und zwar auch im Kontext von Arbeit. Vielleicht ist das im Heimatland anders und dann ist das ein Thema, das in den Familien besprochen werden muss.
Natürlich ist das Familienleben Privatsache. Bei Bezug von Sozialleistungen muss jedoch alles daran gesetzt werden, diesen Bezug durch Arbeitsaufnahme zu beenden. Das Dritte ist, dass auch Unternehmen noch mehr tun können. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Qualifikationen und Kompetenzen von Frauen aus den Hauptherkunftsländern, zum Beispiel Afghanistan und Syrien, weniger Berücksichtigung finden. In den Studien ist zum Teil von Diskriminierung die Rede. Da müssen also alle Seiten mehr tun.
Jetzt ist geplant, dass Menschen aus der Ukraine, die nach einem bestimmten Datum nach Deutschland gekommen sind, nicht mehr Bürgergeld, sondern Asylbewerberleistungen bekommen. Was bedeutet das für die Betreuung durch die Jobcenter?
Die Jobcenter vor Ort sind überwiegend gemeinsame Einrichtungen, bestehen zu 50 Prozent aus den kommunalen Strukturen und zu 50 Prozent aus den BA-Strukturen. Das heißt, das Thema bleibt im BA-Kosmos. Wir haben uns als Bundesagentur für Arbeit nicht um diese Umstellung beworben, aber wenn es so entschieden ist, ist uns wichtig, dass wir an die Erfolge anknüpfen können und viele Menschen auch in dieser schwierigen konjunkturellen Phase in Arbeit bringen.
Wir wollen nach wie vor die Communitys in den Integrationsprozess einbeziehen und weiter aktiv Unternehmen ansprechen. Wichtig ist auch, dass die Verwaltungen wie BA, Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiterhin Pragmatismus an den Tag legen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, können wir die Menschen weiter gut betreuen. Allerdings muss auch sichergestellt werden, dass das finanziell nicht zulasten der Arbeitslosenversicherung, also der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, geht.
Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass allen Akteuren klar ist, wie wichtig Menschen aus dem Ausland für den deutschen Arbeitsmarkt sind?
Spätestens nach der Corona-Pandemie ist meiner Wahrnehmung nach jedem völlig klar, dass alleine die Demografie so viel stärker ist als zum Beispiel die aktuelle konjunkturelle Schwächephase. Die Deutschen im erwerbsfähigen Alter werden jetzt weniger. Das Beschäftigungswachstum ist ausschließlich auf Ausländerinnen und Ausländer zurückzuführen. Das ist keine politische Bewertung, sondern das sind die nackten Zahlen. Mein Eindruck ist, dass die Entscheider im politischen Raum das ganz überwiegend verstanden und auch verinnerlicht haben.
Wo sehen Sie beim Thema Fachkräfteeinwanderung die größten Baustellen?
Wir haben zwar eines der liberalsten Einwanderungsgesetze, die es weltweit gibt. Aber die Prozesse in der Verwaltung sind bürokratisch. Es geht darum, die öffentlichen Strukturen so miteinander zu verzahnen und zu digitalisieren, dass sie zum offenen Geist des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes passen. Sowohl Bund als auch Länder und Kommunen sind an diesen Prozessen beteiligt und arbeiten nicht von vornherein aufeinander abgestimmt. Künftig brauchen wir mindestens 400.000 Menschen im Jahr, die nach Deutschland kommen. Dafür brauchen wir nachvollziehbare, digitale Prozesse. Das ist auch eine Frage des internationalen Wettbewerbs um Arbeitskräfte.
Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang Faktoren wie soziales Umfeld und Willkommensgefühl?
Das ist ein ganz zentrales Thema, auf das wir alle gemeinsam achten und bei dem wir weiterkommen müssen. Hinzu kommt die Sprache am Arbeitsmarkt und in Behörden – vieles geht ausschließlich auf Deutsch und nicht auf Englisch, wie es etwa in Skandinavien oder den Niederlanden ist. Das könnte vielen Fachkräften aus dem Ausland zumindest beim Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen.
Kommen wir zur teils sehr harschen Bürgergeld-Debatte der letzten Monate. Wie blicken Sie auf das Thema?
Für uns ist wichtig, dass die Grundsicherung jetzt die Chance hat, Kontinuität zu bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort müssen einen klaren Rahmen haben, in dem sie langfristig mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten können. Und dann brauchen wir auch ein sinnvolles Ausbalancieren von Fördern und Fordern. Natürlich gehören dazu auch Möglichkeiten, um die wenigen Menschen, die nicht kooperieren, zurück an den Tisch zu holen. Wichtig ist auch, in die Digitalisierung der Grundsicherung weiter zu investieren. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern mehr im digitalen Raum begegnen können und auch Prozesse in der Grundsicherung deutlich vereinfachen. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es, diese Debatte zu entemotionalisieren, um der Ratio wieder einen größeren Raum zu geben. Man kann alles sachlich, gerne auch kontrovers, diskutieren – aber anhand von Daten und Fakten. Dann wäre schon viel gewonnen. (epd/mig) Aktuell Interview Wirtschaft
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Bundesamt Anhörung syrischer Asylbewerber wieder aufgenommen…
- DIW-Studie Frauen und Migranten fürchten Kriminalität überproportional
- Nebenan Was für ein erbärmlicher Haufen
- Amtliche Zahlen Als Prostituierte sind ganz überwiegend…
- Alabali Radovan im Gespräch Ministerin: Von Entwicklungshilfe profitieren…
- 80 Jahre Potsdamer Konferenz Entnazifizierung, Entmilitarisierung, Entschädigung