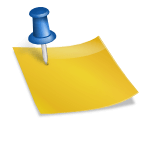Von Reineke Fuchs lernen
Stille Diskriminierung im Deutschunterricht
Begabte Kinder mit ausländischen Wurzeln landen in Förderklassen – nicht wegen mangelnder Leistung, sondern wegen falscher Wahrnehmung. Ein Erfahrungsbericht über stille Diskriminierung.
Von Edgar Pocius Sonntag, 03.08.2025, 11:19 Uhr|zuletzt aktualisiert: Sonntag, 03.08.2025, 11:19 Uhr Lesedauer: 5 Minuten |
Ein Seminar mit zukünftigen Deutschlehrkräften. Thema: deutsche Märchen, genauer gesagt – Reineke Fuchs. Der Stundenverlauf ist minutiös geplant, in Phasen unterteilt, alles zeitlich exakt durchdacht. Nichts darf improvisiert wirken, denn jede Minute muss dokumentiert, jede Methode begründet werden. Ganz anders als im Deutschunterricht für Fremdsprachige: Dort gibt es Material für eine Woche, zwei Tests – und dazwischen gestalte ich den Unterricht weitgehend frei. Wie ich mit dem Stoff umgehe, bleibt meine Entscheidung. Bei jungen Erwachsenen funktioniert Selbstlernen oft gut. Ich freue mich, wenn sie sich mit ihren Handys selbst Antworten suchen. Wissen, das man sich eigenständig erarbeitet, bleibt einfach besser haften.
Doch wie ist das bei Kindern, deren erste Sprache nicht Deutsch ist? Kinder, die sich erst im deutschen Schulsystem zurechtfinden müssen?
Ich hospitiere in zwei kleinen Förderklassen. Am ersten Tag sitze ich still am Ende des Raumes, beobachte, protokolliere. Alles folgt einem klaren Ablauf, jede Phase ist geplant. Die Kinder stellen sich vor. Sie haben unterschiedliche Herkunftsgeschichten, sprechen unterschiedliche Sprachen. Einige leben schon lange in Deutschland, andere sind erst seit Kurzem hier – manche sogar hier geboren. Bei einigen ist kein Akzent zu hören, keine offensichtlichen sprachlichen Defizite. Ich hoffe, dass sie nicht allein wegen ihres Namens oder ihrer Herkunft als „förderbedürftig“ eingestuft wurden.
Sprachkompetenz ist komplex. Theorie und Praxis klaffen oft auseinander. Ich erinnere mich an einen Schüler aus meinem A2-Kurs, der fast fließend sprach, aber kaum einen Grammatiktest bestand. Ein anderer konnte Grammatikregeln auswendig, doch er kämpfte mit dem freien Sprechen im Alltag.
„Wären diese Mädchen anders eingeordnet worden, wenn sie keine Migrationsgeschichte hätten?“
In der Klasse erzählen die Kinder von Lieblingstieren und Spielzeugen. Gerade Literaturunterricht kann helfen, abstraktes und metaphorisches Denken zu fördern – Fähigkeiten, die in einer durchgetakteten Welt oft unterschätzt werden. Die Stunde gelingt. Die Kinder sind aufmerksam, beteiligen sich, haben Raum, sich zu äußern. Die kleine Gruppengröße macht das möglich. Zwei Mädchen stechen heraus. Sie wirken hochbegabt – aber sie sind nicht im Regelunterricht. Die eine antwortet schneller, als die Lehrerin die Frage beendet. Die andere stellt kluge, weiterführende Fragen, denkt mit, denkt weiter.
Solches Denken, dieses kreative Engagement, wird nicht immer als Stärke wahrgenommen. In einem starren Unterrichtsplan gilt es schnell als Störung. In großen Klassen erscheint es vielen Lehrkräften eher als Problem denn als Potenzial. Ich frage mich: Wären diese Mädchen anders eingeordnet worden, wenn sie keine Migrationsgeschichte hätten? Wenn ihre Eltern Akademiker wären?
Ich denke zurück: Hätte ich selbst mein Abitur geschafft, wenn meine Eltern als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen wären? Ich war ein leiser, zurückhaltender Schüler, ein Spätzünder mit Legasthenie. Texte muss ich noch heute mehrfach überarbeiten. Mein Lernweg war nie linear. Ich verstand Lernen als etwas Schöpferisches. Vielleicht wäre ich in einer Förderklasse gelandet – und hätte den Weg zum Studium nie eingeschlagen.
Am nächsten Tag darf ich die Einleitung der Unterrichtsstunde gestalten. Dreißig Minuten lang. Ich erkläre: Tiere in Fabeln stehen für menschliche Eigenschaften. Der Hase ist schnell, aber ängstlich. Der Bär stark, aber der Honig seine Schwäche. Ich spüre: Die Kinder machen engagiert mit. Doch verstehen sie, dass es nicht um Tiere geht, sondern um Menschen?
„Es reicht nicht, etwas zu können. Entscheidend ist oft, wie man wahrgenommen wird.“
Dann der Fuchs. Nicht der Stärkste. Nicht der Schnellste. Und doch gewinnt er. Warum? Weil er beobachtet. Weil er Schwächen erkennt. Weil er denkt. Nicht prahlt. Nicht droht. Sondern trickst. Reineke zeigt: Wer unterschätzt wird, kann gerade dadurch gewinnen.
Nach meinem Teil übernehmen die Lehrkräfte wieder. Das vorbereitete Skript läuft routiniert, die Kinder bleiben interessiert. Ich frage mich: Was macht gute Lehre eigentlich aus? Ich erinnere mich an Professor:innen, die nach einem spannenden Seminar zum Kaffee oder Bier einluden – und an andere, die seelenlos ihre PowerPoint präsentierten und wortlos verschwanden. Kein System ist perfekt. Aber manche Menschen machen einen Unterschied.
Nach der Stunde sagt die Lehrerin einen Satz, der mir im Kopf bleibt:
„Hauptsache, die Kinder haben mal den Namen Goethe gehört – später wissen sie vielleicht, dass es so einen Schriftsteller gab.“
Ein Satz, der traurig stimmt. Nicht alle müssen Schriftsteller werden – aber diese Kinder waren nicht desinteressiert!
Ich denke zurück an meine eigene Schulzeit. An einen Moment, als ich ein Thema gut verstanden hatte – mein bester Freund, beliebt und als „Musterschüler“ bekannt, schrieb in der Arbeit vieles von mir ab. Am Ende bekam er eine bessere Note. Ich lernte viel zu spät: Es reicht nicht, etwas zu können. Entscheidend ist oft, wie man wahrgenommen wird. Leistung allein reicht nicht – man wird übersehen, wenn man nicht ins Bild passt.
„Schule ist nicht nur Ort der Leistung. Sondern auch der weichen Kompetenzen.“
Ich hoffe, dass die Kinder aus dieser Stunde etwas mitnehmen – nicht nur den Namen „Goethe“. Sondern auch die Lehre aus Reineke Fuchs: Dass man auch ohne Kraft erfolgreich sein kann. Dass praktische Intelligenz manchmal stärker ist als gebüffeltes Wissen. Dass es Vorteile hat, unterschätzt zu werden – wenn man die Welt gut beobachtet und versteht, wie andere denken.
Die Fabel entstand in der Zeit der deutschen Kleinstaaterei – voller höfischer Intrigen. Währenddessen tobte in Frankreich die Revolution. Die Elite wurde gestürzt, doch das Leben wurde nicht besser. Neue Machtkämpfe, mehr Chaos.
Ein kluger Herrscher muss die Tiere kennen: Wer läuft dem Honig nach, wer strebt nach Status, wer wirkt still – aber sieht alles. Nur wer die Dynamiken erkennt, kann langfristig gute Politik machen.
Vielleicht lernen auch die Kinder: Schule ist nicht nur Ort der Leistung. Sondern auch der weichen Kompetenzen. Der Resilienz. Und des inneren Kompasses.
Reineke Fuchs bleibt ein zwiespältiger Antiheld. Moralisch fragwürdig, taktisch brillant. Und vielleicht gerade deshalb ist das Märchen, das die tiefere Menschennatur offenbart, auch heute aktuell. (mig) Meinung
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Widerrufsprüfungen von Geflüchteten: 93 Prozent…
- „Stoppt die Boote“ Britische Rechtsextremisten jagen Geflüchtete an…
- Minnesota Das Unvorstellbare ist näher, als wir denken
- Neue Entwicklungspolitik Alabali Radovan: Deutschland gibt Kampf gegen…
- Wahlkampf in Bayern AfD will Einbürgerung nur noch für Reiche –…
- Bundesagentur Ohne ausländische Beschäftigte geht es nicht mehr