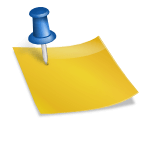Zwischen Unsichtbarkeit & Teilhabe
62 Jahre marokkanische Migration
Vor 62 Jahren wurde das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Marokko unterzeichnet. Bis heute ist marokkanische Community in Deutschland weitestgehend unsichtbar – besonders Frauen. Warum?
Von Dr. Soraya Moket Dienstag, 20.05.2025, 12:17 Uhr|zuletzt aktualisiert: Dienstag, 20.05.2025, 12:24 Uhr Lesedauer: 3 Minuten |
„Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.“ – Max Frischs Zitat aus dem Jahr 1965 fasst treffend zusammen, wie Deutschland mit der sogenannten Gastarbeiter:innenpolitik umging.
Am 21. Mai 1963 wurde das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Marokko unterzeichnet – ein wirtschaftlich motiviertes Projekt, das rasch zu einer dauerhaften Migrationserfahrung für tausende marokkanische Familien wurde. 62 Jahre später stellt sich die Frage: Wie wird diese Erfahrung in der deutschen Gesellschaft anerkannt? Und wer erhält diese Anerkennung überhaupt?
Unsichtbare Realität trotz prägender Geschichte
Die marokkanische Migration ist kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil deutscher Geschichte. Trotzdem bleibt die Community trotz jahrzehntelanger Arbeit, sozialer Beiträge und wirtschaftlicher Leistungen weitgehend unsichtbar. Besonders Frauen, die seit den 1960er Jahren eine tragende Rolle übernahmen, werden bis heute kaum gewürdigt. Sie arbeiteten in Industrie und Dienstleistung, aber auch in den Familienstrukturen, stärkten kulturelle Identität und förderten die Teilhabe ihrer Kinder. Ihre Leistungen sind vielfach unsichtbar geblieben – in der öffentlichen Erinnerung ebenso wie in politischen Entscheidungen.
Diese Unsichtbarkeit ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis politischer und struktureller Ausschlussmechanismen: in Medien, Politik und Erinnerungskultur. Es stellt sich die Frage: Wie könnte eine postmigrantische Erinnerungspolitik aussehen, die Geschichte nicht nur anerkennt, sondern auch Konsequenzen daraus zieht? Wie lassen sich Forderungen nach Teilhabe wirksam durchsetzen?
Vier Generationen – eine geteilte Erfahrung
Die marokkanische Migration in Deutschland lässt sich in vier Phasen gliedern, die durch strukturelle Ausgrenzung und kollektiven Widerstand geprägt sind:
Anwerbephase (1963–1973): Deutschland holte marokkanische Arbeitskräfte, vor allem Männer, aber auch Frauen, zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs. Die Migration war als temporär gedacht. Rückkehr war politisch gewollt, gesellschaftliche Teilhabe hingegen nicht.
Familiennachzug und Bleibeperspektiven (1973–1980er): Nach dem Anwerbestopp kam es zum Familiennachzug. Frauen gewannen zunehmend an Bedeutung für das gesellschaftliche Leben, oft unter schwierigen Bedingungen und Mehrfachdiskriminierung.
Aufbruch und Sichtbarkeit (1980er–1990er): Die zweite Generation forderte Bildungsrechte, organisierte sich politisch und stellte sich gegen institutionellen Rassismus. Der Wunsch nach Teilhabe wurde lauter und sichtbarer.
Diversifizierung (2000er bis heute): Akademiker:innen, Künstler:innen und Unternehmer:innen prägen heute das Bild der marokkanischen Diaspora. Dennoch bleibt die Repräsentation, insbesondere in Politik, Medien und Verwaltung, stark eingeschränkt.
Trotz anhaltender struktureller Barrieren haben viele Menschen marokkanischer Herkunft in Deutschland bemerkenswerte Erfolge erzielt. Sie sind Vorbilder in Bildung, Wirtschaft, Kultur und Politik. Ihr Engagement ist Ausdruck von Resilienz und der Forderung nach Gleichstellung – nicht nur symbolisch, sondern konkret und strukturell.
Weiterführende Infos: Deutsch-Marokkanische Lebenswege
Frauen als Trägerinnen des Wandels
In allen Phasen der Migration waren Frauen zentrale Akteurinnen. Sie bauten Brücken zwischen Herkunft und Ankunft, gründeten Vereine, förderten Bildung und begleiteten ihre Kinder in einer komplexen Lebensrealität. Doch ihre Leistungen bleiben unsichtbar – auch heute. Diese Marginalisierung ist Ausdruck patriarchaler und rassistischer Strukturen, die weibliche Migrationsgeschichten ausblenden.
Rassismuskritische Erinnerungspolitik als Verpflichtung
Während Jubiläen wie „60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei“ öffentlich begangen werden, bleibt die Geschichte der marokkanischen Migration im Schatten. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Deutsch-Marokkanische Kompetenznetzwerk (DMK) bemühen sich um Sichtbarkeit. Doch politische Entscheidungsträger:innen sprechen der Community teils die Relevanz ab: zu klein, zu leise, bereits integriert. Diese Haltung zeigt ein strukturelles Missverständnis: Anerkennung wird als Gnade verstanden, nicht als Recht.
Ein politischer Appell
Wer Migration als Teil deutscher Geschichte versteht, muss sie institutionell anerkennen: durch rassismuskritische Erinnerungspolitik, echte politische Teilhabe und Sichtbarkeit in Bildung, Medien und Entscheidungsprozessen. Die marokkanische Community – mehr als 300.000 Menschen – fordert keine Sonderbehandlung, sondern Gerechtigkeit.
Die Würdigung dieser Geschichte darf nicht bei symbolischen Gedenktagen enden. Sie muss sich in politischen Entscheidungen, strukturellem Wandel und einer inklusiven Selbstbeschreibung Deutschlands zeigen. Marokkanische Migration ist Teil deutscher Realität – gestern, heute und morgen. (mig) Meinung
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Berlin-Monitor Jeder Dritte fühlt sich von Muslimen bedroht
- Das Repressionskarussell Erst gegen Geflüchtete – dann gegen alle
- „Perfide Menschenjagd“ CDU-Minister fordert Handyortung und Observation von…
- Keine Behörde ohne Rassismus Ataman: Innenminister Dobrindt ignoriert eigene…
- „Missbräuchliche Vaterschaft“ Wenn die Ausländerbehörde entscheidet, wer Vater ist!
- Flüchtlingspolitik Athen und Berlin planen Abschiebelager in Afrika