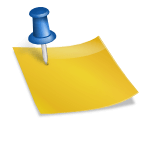Anleitung
Kampf gegen Rechtsextremismus? So geht’s
Was sind die Ursachen für Rechtsextremismus und wie kann er bekämpft werden? Die Wissenschaft hat dazu bereits Antworten geliefert. Dem Staat kommt eine zentrale Rolle zu.
Von Dr. Mario Peucker Sonntag, 18.05.2025, 10:12 Uhr|zuletzt aktualisiert: Freitag, 16.05.2025, 9:52 Uhr Lesedauer: 5 Minuten |
Dass Rechtsextremismus in Deutschland längst kein gesellschaftliches Randphänomen mehr ist, belegen wissenschaftliche Untersuchungen – wie etwa die Leipziger Autoritarismus-Studienreihe – seit vielen Jahren. Wer bislang noch Zweifel daran hatte, den sollte spätestens die Tatsache überzeugen, dass über 10 Millionen Deutsche bei der letzten Bundestagswahl der „gesichert rechtsextremen“ AfD ihre Stimme gaben – was auch immer ihre persönlichen Gründe für diese Wahlentscheidung gewesen sein mögen.
Einstellungen, die typischerweise mit Rechtsextremismus assoziiert werden – wie etwa Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, antidemokratischer Autoritarismus oder gar die Verharmlosung des Nationalsozialismus –, reichen zum Teil tief in die gesellschaftliche Mitte. So vertreten laut der Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 über ein Drittel der Befragten die Meinung, dass Deutschland „durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet“ sei. Fast ein Viertel stimmt zumindest teilweise der Aussage zu, dass „wir einen Führer haben sollten, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert“.
Nicht jede Person, die solche Meinungen vertritt, ist automatisch rechtsextrem. In der Extremismusforschung wird die Bedeutung ideologischer Haltungen in Radikalisierungsprozessen oft kritisch hinterfragt und zum Teil als sekundär gegenüber anderen Faktoren eingestuft. Es steht jedoch außer Frage, dass Menschen mit fremdenfeindlichen, autoritären und nationalchauvinistischen Einstellungen deutlich empfänglicher sind für die Mobilisierungs- und Rekrutierungsversuche rechtsextremer Gruppierungen und Parteien.
Neben diesen ideologischen Einstellungen weist die (Rechts-)Extremismusforschung seit Langem auf weitere sozialpsychologische und zum Teil sozioökonomisch-strukturelle Faktoren hin, die Menschen anfälliger für rechtsextreme Radikalisierung machen können. Ein besonders zentrales Erklärungsmodell, das bereits seit den 1990er Jahren von vielen Expert:innen vertreten wird und inzwischen empirisch gut belegt ist, argumentiert, dass grundlegende technologische sowie regionale und globale ökonomische Transformationsprozesse zu einer grundlegenden sozialen Neuordnung geführt haben. In dieser neuen Ordnung sehen sich bestimmte Gruppen – oft Männer mit niedrigerem formalen Bildungsniveau und in eher gering qualifizierten Berufen – zunehmend als „Modernisierungsverlierer“. Angetrieben von Statusverlust- und Abstiegsängsten sowie dem Gefühl, trotz harter Arbeit von der Gesellschaft an den Rand gedrängt zu werden, neigen diese Menschen eher dazu, ihr Heil in den falschen und oft nostalgischen Versprechungen rechtspopulistischer oder rechtsextremer Gruppen zu suchen. Viele Studien haben diese Modernisierungsverlierer-Hypothese auch für Deutschland empirisch bestätigt.
Ein zweiter zentraler Erklärungsansatz für rechtsextreme Radikalisierungsprozesse ist mit diesem Modell verwandt, stellt jedoch weniger strukturelle als vielmehr psychologische Faktoren in den Mittelpunkt: das zutiefst menschliche Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und Respekt. In der Forschung ist hier oft von einer „Suche nach Signifikanz“ die Rede, also dem Streben nach sozialer Bedeutung – oder in der englischsprachigen Literatur: „the desire to matter, to be someone and to have meaning in one’s life“. Wenn Menschen den Eindruck haben, diese grundlegenden Bedürfnisse nicht hinreichend in einem pro-sozialen und demokratischen Umfeld befriedigen zu können – so die zunehmend anerkannte wissenschaftliche Einschätzung –, dann besteht eine erhöhte Gefahr, dass andere, oft auch rechtsextreme Milieus und Gruppierungen an Attraktivität gewinnen. Wer sich hingegen in einem sozialen Umfeld bewegt, in dem man sich eingebunden, respektiert und anerkannt fühlt, dürfte deutlich weniger anfällig sein für die falschen Versprechungen von rechts außen. Auch dies ist inzwischen empirisch gut belegt.
Wenn wir diese Ausführungen zu Einstellungen, Statusverlustängsten und dem zutiefst menschlichen Bedürfnis nach Anerkennung zugrunde legen, sollte jeder Zweifel ausgeräumt sein: Empfänglichkeiten für Rechtsextremismus betreffen nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen, sondern sind ein Problem in allen Teilen und Schichten der Gesellschaft.
Was bedeutet das für eine effektive Bekämpfung des Rechtsextremismus?
Rechtsextremismus stellt eine zentrale Bedrohung unserer demokratischen Grundordnung dar – doch demokratische Haltungen, Prozesse und Strukturen sind zugleich auch unser bestes Bollwerk. In meinem kürzlich veröffentlichten Buch Democracy Strikes Back. Understanding and Countering the Rise of the Far-Right werden vier zentrale Ansätze diskutiert:
- Bildungsmaßnahmen zur Stärkung liberal-demokratischer Grundwerte, kritischen Denkens und digitaler Kompetenz
Wie Oskar Negt 2024 betonte: „Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss.“ Die Resonanz rechtsextremer Mobilisierung und Propaganda kann durch eine Ausweitung der schulischen und außerschulischen Menschenrechtsbildung und Antirassismusarbeit effektiv reduziert werden. Darüber hinaus bedarf es einer systematischen Stärkung demokratischer Reflexionsfähigkeit, kritischen Denkens und digitaler Kompetenzen (‚digital literacy‘) – insbesondere bei jungen Menschen. - Öffentliche Räume für demokratischen Dissens, Protest und Diskurs
Die Forschung zeigt, dass Menschen, die das Gefühl haben, ihre Meinungen und Sorgen würden im öffentlichen Diskurs und in der Politik ignoriert, sich eher offen zeigen für die Ansprache rechtsextremer und rechtspopulistischer Gruppen. Um dem vorzubeugen, bedarf es präventiver Ansätze zur Ausweitung basisdemokratischer Prozesse – insbesondere auf lokaler Ebene. Ziel ist es, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre – auch und gerade kritischen – Perspektiven frühzeitig und konstruktiv in den demokratischen Diskurs einzubringen. Aktuelle Tendenzen, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit einzuschränken, sind hier kritisch zu hinterfragen – wenngleich menschenverachtende Haltungen keine zusätzlichen öffentlichen Plattformen geboten werden dürfen. - Stärkung pro-demokratischer zivilgesellschaftlichen Strukturen
Kaum ein anderes Land der Welt verfügt über eine zivilgesellschaftliche Landschaft, die so etabliert und kompetent im Umgang mit Rechtsextremismus ist wie Deutschland. Diese Strukturen sind über Jahrzehnte hinweg aufgebaut worden – auch dank staatlicher Förderung – und bilden das Rückgrat der Rechtsextremismusbekämpfung. Die deutsche Politik und Gesellschaft sollte stolz auf diese zivilen Strukturen sein und sie weiter und verstärkt fördern. - Mehr pro-soziale Gelegenheitsstrukturen zur Befriedigung der Bedürfnisse nach sozialer Anerkennung
Wenn die Rechtsextremismusforschung richtig liegt, besteht ein zentraler Präventionsansatz darin, gesellschaftliche Strukturen zu schaffen, in denen Menschen soziale Anerkennung und Respekt finden können. Die Möglichkeiten sind vielfältig – vom Ausbau niedrigschwelliger Sportangebote, der gezielten Gestaltung öffentlicher Sozialräume (z. B. Spielplätze), über die Unterstützung lokaler Bürgerinitiativen und Gemeindeprojekte (z. B. Gemeinschaftsgärten) bis hin zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Mitspracherechte am Arbeitsplatz. All dies mag auf den ersten Blick wenig mit Rechtsextremismusbekämpfung zu tun haben – doch gerade darin liegt das Potenzial solcher pro-sozialer Strukturen, die weitreichende positive Effekte auf das demokratische Zusammenleben haben.
Der Kampf gegen Rechtsextremismus kann nicht allein mit sicherheitspolitischen und politisch-rechtlichen Maßnahmen gewonnen werden. Auf der Basis einer sachlichen Problemdiagnose – insbesondere im Hinblick auf die weitreichende Empfänglichkeit für rechtsextreme Mobilisierung – bedarf es der viel zitierten „gesamtgesellschaftlichen Anstrengung“, die bestehende demokratische und zivilgesellschaftliche Potenziale erkennt, nutzt und weiter ausbaut. Dem Staat kommt eine zentrale Rolle zu, diese Strukturen dauerhaft zu stärken. Es war nie wichtiger als in den aktuellen Zeiten. Meinung
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Berlin-Monitor Jeder Dritte fühlt sich von Muslimen bedroht
- Das Repressionskarussell Erst gegen Geflüchtete – dann gegen alle
- „Perfide Menschenjagd“ CDU-Minister fordert Handyortung und Observation von…
- Keine Behörde ohne Rassismus Ataman: Innenminister Dobrindt ignoriert eigene…
- „Missbräuchliche Vaterschaft“ Wenn die Ausländerbehörde entscheidet, wer Vater ist!
- Flüchtlingspolitik Athen und Berlin planen Abschiebelager in Afrika