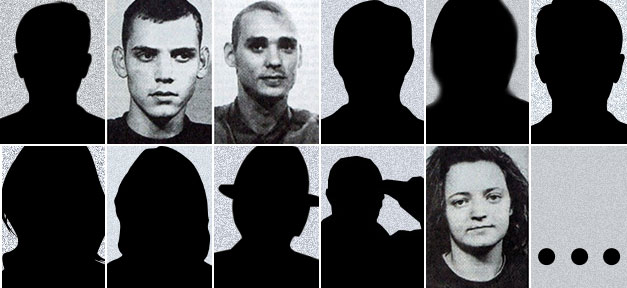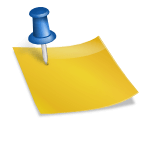Studie
Forscher beklagen lückenhafte Umsetzung der NSU-Empfehlungen
Viele Empfehlungen zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes sind bis heute nicht vollständig umgesetzt. Eine neue Studie beklagt gravierende Defizite – von fehlender Transparenz bis zu mangelndem Opferschutz.
Sonntag, 14.09.2025, 12:02 Uhr|zuletzt aktualisiert: Sonntag, 14.09.2025, 12:02 Uhr Lesedauer: 2 Minuten |
Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena kritisiert Mängel bei der Umsetzung der Empfehlungen der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse (PUA) zum NSU-Komplex. In den Ausschüssen war das Behördenversagen beim Umgang mit der rechtsextremen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) untersucht worden. Die Umsetzung der Vorschläge bleibe ein zentraler Maßstab für das Handeln von Politik und Verwaltung, schreiben die Autor*innen in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie.
Der Umfang der verfügbaren Informationen sei stark begrenzt, was die Aussagekraft der Studie einschränke und „grundsätzliche Fragen zur Transparenz politischen und behördlichen Handelns“ aufwerfe. Aus den Dokumentationssystemen des Bundestags und der Landtage sowie anderen öffentlich zugänglichen Quellen ließen sich nur unvollständige, unspezifische oder veraltete Daten zu staatlichen Maßnahmen gewinnen.
Laut Autorin Janina Wollman gab es in den vergangenen Jahren zwar wichtige Neuerungen beim Informationsaustausch zwischen Behörden. Doch gerade im Umgang mit Betroffenen rassistischer Gewalt sowie in der Weiterbildung von Polizei und Justiz zu Rechtsextremismus und Rassismus gebe es weiterhin erhebliche Defizite. Fraglich sei auch, inwieweit Ausbildungsinhalte sowie Sensibilisierungs- und Diversifizierungsprogramme tatsächlich flächendeckend verankert sind.
Strukturen behindern Fehlerkultur
Das IDZ verweist zudem auf ein fortbestehendes „unbewusstes Unfehlbarkeitsparadigma“, eine „Wagenburgmentalität“ und einen „problematischen Korpsgeist“ innerhalb der Polizei. Diese Strukturen behinderten eine offene Fehlerkultur. Auch im Bereich des Opferschutzes, bei der Strafverfolgung rechtsextremer und rassistischer Taten sowie bei der Entwaffnung der rechtsextremen Szene gebe es laut Studie bis heute gravierende Umsetzungsdefizite.
Darüber hinaus bemängeln die Forschenden, dass sich vielerorts nicht klären lasse, ob beschlossene Reformen tatsächlich den Behördenalltag verändert haben. „Es muss offenbleiben, inwieweit sich einige, relativ allgemein gehaltene Empfehlungen konkret in veränderten Behördenpraktiken und Dienstvorschriften niedergeschlagen haben“, heißt es im Fazit. Stattdessen entstehe der Eindruck einer „Black Box“, da systematische interne Monitorings und regelmäßige Berichte fehlten.
Experten fordern „Transparenzoffensive“
Die Studie fordert deshalb eine „Transparenzoffensive“ und eine systematische, fortlaufende Berichterstattung über den Stand der Umsetzung. Nur so könnten Bürgerinnen und Parlamentarierinnen nachvollziehen, ob staatliche Versprechen eingehalten und demokratische Standards dauerhaft gesichert werden.
Das erste Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe, der türkische Blumenhändler Enver Simsek, war vor 25 Jahren, am 9. September 2000 in Nürnberg niedergeschossen worden und am 11. September seinen Verletzungen erlegen. (epd/mig) Leitartikel Panorama
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Neue Entwicklungspolitik Alabali Radovan: Deutschland gibt Kampf gegen…
- Wahlkampf in Bayern AfD will Einbürgerung nur noch für Reiche –…
- Sachsen Über 600 Kinder ohne Schulplatz – alle ohne deutschen Pass
- „Stoppt die Boote“ Britische Rechtsextremisten jagen Geflüchtete an…
- Minnesota Das Unvorstellbare ist näher, als wir denken
- Bundesagentur Ohne ausländische Beschäftigte geht es nicht mehr