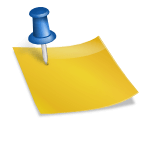Mythos Ablehnung
Bürgerentscheide zu Geflüchteten: Mehrheit stimmt für Unterkünfte
Wenn Bürger über Flüchtlingsunterkünfte entscheiden, fällt das Votum in der Mehrheit positiv aus – entgegen dem Eindruck, den mediale Schlagzeilen häufig vermitteln. Eine neue Studie zeigt, wie differenziert kommunale Bürgerentscheide in Deutschland tatsächlich sind.
Montag, 26.05.2025, 10:12 Uhr|zuletzt aktualisiert: Montag, 26.05.2025, 9:42 Uhr Lesedauer: 3 Minuten |
In Deutschland finden statistisch gesehen an jedem Wochenende drei Bürgerentscheide statt. Das bedeute, in drei Städten, Gemeinden und Kreisen stimmten die Bürgerinnen und Bürger über ein konkretes lokalpolitisches Thema ab, heißt es in dem Bürgerbegehren-Bericht für das Jahr 2025 des Fachverbandes „Mehr Demokratie“.
Ein zentrales Thema der vergangenen Jahre in der Öffentlichkeit war dabei die Unterbringung von Geflüchteten. Medien berichteten über solche Verfahren oft nur dann, wenn Bürgerinitiativen gegen Geflüchtetenunterkünfte mobilisieren oder rechtliche Auseinandersetzungen folgten. Das erweckte den Eindruck, als sei die anfängliche Solidarität mit Geflüchteten gesunken, die Willkommenskultur verschwunden.
Der neue Bericht zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild: Von 2015 bis 2024 wurden bundesweit 94 Verfahren zu Flüchtlingsunterkünften initiiert. Das entspricht gerade einmal rund drei Prozent aller Bürgerbegehren in diesem Zeitraum. In 27 Fällen kam es zu einem Bürgerentscheid, bei dem die Mehrheit in 16 Fällen ein flüchtlingsfreundliches Votum abgab. Zehn Entscheidungen fielen flüchtlingsunfreundlich aus, ein Entscheid blieb neutral.
Regionale Unterschiede und rechtliche Grenzen
Die Mehrheit der Verfahren verteilte sich auf Nordrhein-Westfalen (26), Bayern (19) und Baden-Württemberg (19). Gerade in den westlichen Bundesländern stimmten 16 von 23 Kommunen für den Bau oder Erhalt einer Flüchtlingsunterkunft, was einem Anteil von knapp 70 Prozent entspricht. In Ostdeutschland dagegen gab es vier Entscheide, alle in Mecklenburg-Vorpommern, die ausnahmslos flüchtlingsunfreundlich ausgingen. In zwei Fällen lehnten Bürger Ratsreferenden zur Verpachtung kommunaler Flächen für Unterkünfte ab.
Auffällig sei, so der Bericht, dass sich einige Bürgerbegehren grundsätzlich gegen die Aufnahme von Geflüchteten richteten – ein Anliegen, das laut Aufenthaltsgesetz nicht in den kommunalen Entscheidungsbereich fällt und damit unzulässig ist. Insgesamt wurden 43 Verfahren als unzulässig eingestuft.
Warnung vor Missbrauch direkter Demokratie
Die Studienautoren warnen davor, die direkte Demokratie für populistische oder fremdenfeindliche Ziele zu instrumentalisieren. Initiatoren solcher Verfahren trügen Verantwortung dafür, nicht bewusst falsche Erwartungen zu wecken. Ein Bürgerbegehren könne nicht darüber entscheiden, ob eine Kommune Geflüchtete aufnimmt – nur darüber, wo und wie sie untergebracht werden.
Trotz einzelner flüchtlingsunfreundlicher Entscheidungen überwiegt laut Bericht der Eindruck, dass Bürgerentscheide oft differenzierter ausfallen als die öffentliche Wahrnehmung nahelegt. Es sei eine Frage der politischen Verantwortung, der Polarisierung mit Information und Beteiligung zu begegnen. Frühzeitige Dialogformate, wie etwa kommunale Bürgerräte oder das Projekt „Sprechen & Zuhören“ von Mehr Demokratie, könnten dazu beitragen, Konflikte zu entschärfen und demokratische Teilhabe zu stärken.
Bürgerbeteiligung bleibt stabil – trotz Pandemie
Im vergangenen Jahr sind laut dem Bericht 229 direktdemokratische Verfahren in deutschen Kommunen 2024 angestoßen worden. 179 Mal sei es zu einem Bürgerentscheid gekommen. Damit sei die Praxis seit der Corona-Pandemie leicht rückläufig.
Die lebendigste Praxis verzeichne nach wie vor Bayern mit 93 Verfahren, gefolgt von Baden-Württemberg (31) und Nordrhein-Westfalen (30). Vieles hänge von den Regeln und Hürden ab, die die Politik der direkten Demokratie setze, sagte der Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie, Ralf-Uwe Beck. Je besser die Regeln seien, umso häufiger machten die Menschen von der direkten Demokratie Gebrauch.
Appell für bundesweite Volksentscheide
Beck sagte, die direkte Demokratie habe sich auf kommunaler und auch auf Landesebene bewährt. Es sei überfällig, auch den bundesweiten Volksentscheid einzuführen. Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme, die den Bürgerinnen und Bürgern das gute Gefühl gebe, „dass ‚die da oben‘ eben nicht einfach machen können, was sie wollen“, so der Bundesvorstandssprecher.
Laut Fachverband hat es in den vergangenen knapp 70 Jahren in Deutschland 9.453 Bürgerbegehren gegeben. 7.839 der direktdemokratische Verfahren wurden durch die Bürgerinnen und Bürger „von unten“ eingeleitet. 1.614 Ratsreferenden seien „von oben“ durch den jeweiligen Gemeinderat initiiert worden. In 4.768 Fällen sei es letztlich zu einem Bürgerentscheid gekommen.
Missbrauch von Rechtsextremisten
Die Gefahr, dass direktdemokratische Verfahren von Rechtsextremisten massiv missbraucht werden, sieht der Verband eher nicht. „Fremdenfeindlichkeit und direkte Demokratie – die Vermählung gelingt nur selten“, sagte Beck.
So hätten beispielsweise die Menschen im nordrhein-westfälischen Sprockhövel im Jahr 2015 darüber abstimmen können, ob sie gegen eine Flüchtlingsunterkunft neben einer Grundschule sind. Eine Mehrheit sprach sich für die Unterkunft am geplanten Ort aus. (epd/mig) Gesellschaft Leitartikel
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Berlin-Monitor Jeder Dritte fühlt sich von Muslimen bedroht
- Das Repressionskarussell Erst gegen Geflüchtete – dann gegen alle
- „Perfide Menschenjagd“ CDU-Minister fordert Handyortung und Observation von…
- Keine Behörde ohne Rassismus Ataman: Innenminister Dobrindt ignoriert eigene…
- „Missbräuchliche Vaterschaft“ Wenn die Ausländerbehörde entscheidet, wer Vater ist!
- Flüchtlingspolitik Athen und Berlin planen Abschiebelager in Afrika