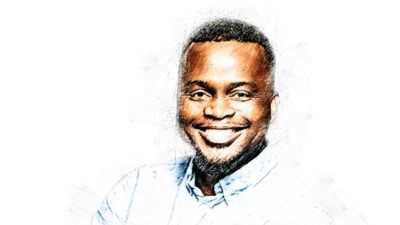
Tag der Deutschen Einheit
Kein Zusammenhalt ohne Sprachvielfalt
Ob Berlin oder Yaoundé: Einheit wird gern beschworen, aber selten gelebt. Ausgerechnet Sprache trennt, statt zu verbinden – Einheit von oben und Vielfalt von unten prallen aufeinander.
Von Dr. Marc Ntouda Sonntag, 05.10.2025, 11:52 Uhr|zuletzt aktualisiert: Sonntag, 05.10.2025, 11:52 Uhr Lesedauer: 4 Minuten |
Am 3. Oktober feiert Deutschland die Einheit. Politiker halten Reden. Fahnen werden gehisst. Die Hymne erklingt. Es ist ein Tag der Erinnerung: an den Mauerfall, an die Wiedervereinigung. Ein Tag der Selbstvergewisserung. Doch Einheit ist mehr als ein politisches Datum. Sie entscheidet sich jeden Tag. Und sie entscheidet sich durch Sprache. Wer spricht, gehört dazu. Wer sprachlich abweicht, steht schnell draußen.
Deutschland gilt als Land mit einer Sprache: Deutsch. So steht es in Verfassung und Gesetz. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Millionen Menschen wachsen hier mehrsprachig auf. Sie sprechen Türkisch zu Hause, Arabisch auf der Straße, Russisch mit Verwandten, Französich in der Nachbarschaft. Deutsch lernen sie dazu, oft als zweite oder dritte Sprache.
Ihr Deutsch klingt anders, mit Akzent, mit Grammatik jenseits der Schulnorm. Für viele ist das selbstverständlich. Doch nicht für die Gesellschaft. Abweichung gilt als Makel. Kiezdeutsch wird verspottet, obwohl es eine eigene Grammatik hat. Wer mit Akzent spricht, gilt als weniger intelligent. Sprache wird so zu einer unsichtbaren Grenze – wie eine Mauer, genauso wirksam.
„Sprache wird so zu einer unsichtbaren Grenze – wie eine Mauer, genauso wirksam.“
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Einheit und Vielfalt zeigt sich nicht nur in Deutschland. Auch Kamerun kennt die Erfahrung, dass politische Einheit auf Kosten sprachlicher und kultureller Vielfalt durchgesetzt wird.
Kamerun: Einheit von oben
Am 1. Oktober 1961 vereinigten sich die britisch verwalteten Southern Cameroons mit der französisch geprägten République du Cameroun. Für die anglophone Bevölkerung ist dieses Datum bis heute der eigentliche Unification Day. Doch die Regierung setzte andere Zeichen.
„Ein Feiertag, der nicht verbindet, sondern spaltet.“
Am 20. Mai 1972 ließ Präsident Ahmadou Ahidjo ein Referendum abhalten. Er hob die föderale Struktur auf und schuf einen zentralistischen Einheitsstaat. Seitdem gilt der 20. Mai als offizieller Nationalfeiertag, der Tag der nationalen Einheit. Für viele Anglophone war das ein Verrat. Bis heute ist das der Kern der anglophonen Krise. Eine politische Entscheidung, die Vielfalt leugnete. Ein Feiertag, der nicht verbindet, sondern spaltet.
Sprache als Schauplatz des Konflikts
Die Sprachpolitik spiegelt diese Spaltung. Kamerun ist eines der sprachlich reichsten Länder Afrikas mit mehr als 250 Sprachen. In den Städten dominiert Camfranglais, eine Mischung aus Französisch, Englisch und lokalen Idiomen. Es ist die Sprache der Jugend, der Märkte, der Musik und der sozialen Medien.
„Einheit von oben und Vielfalt von unten prallen aufeinander.“
Doch im Bildungssystem spielt Camfranglais keine Rolle. Auch lokale Sprachen werden an den Rand gedrängt. In den Klassenzimmern zählt nur Pariser Französisch oder britisches Englisch. Wer sie nicht perfekt beherrscht, gilt als ungebildet. Das Ergebnis ist ein Schulsystem, das am Alltag der Kinder vorbeigeht. Schüler scheitern nicht, weil sie sprachlich arm wären, sondern weil ihre Sprache nicht anerkannt wird. Einheit von oben und Vielfalt von unten prallen aufeinander.
Das Paradox der Einheit
Deutschland und Kamerun scheinen weit auseinanderzuliegen. Doch ihre Einheitsfeiertage zeigen ein ähnliches Paradox. Beide Länder beschwören Einheit. Beide ignorieren Vielfalt.
„Einheit bedeutet Unterordnung unter eine richtige Sprache – verordnete Einheit. „
In Deutschland erleben Kinder mit migrantischem Hintergrund, dass ihre Familiensprache nicht zählt. Integration bedeutet Anpassung an eine Norm. Wer abweicht, wird belehrt oder verspottet. In Kamerun erleben Jugendliche, dass ihre Alltagssprache im Klassenzimmer keine Chance hat. Einheit bedeutet Unterordnung unter eine richtige Sprache. In beiden Fällen wird Einheit nicht gelebt, sondern verordnet. Das Ergebnis sind Misstrauen, Distanz und Konflikte.
Einheit braucht Anerkennung der Realität
Einheit ist kein Synonym für Gleichmacherei. Echte Einheit entsteht, wenn Vielfalt anerkannt wird. Sprache ist dabei Schlüssel und Symbol.
In Deutschland heißt das: Dialekte, Kiezdeutsch und migrantische Sprachen müssen sichtbar werden. Nicht als Ersatz für Standarddeutsch, sondern als Ergänzung. Kinder müssen lernen: Ihre Sprache ist kein Makel, sondern Teil ihrer Identität. Wer das begreift, lernt besser, integriert sich leichter und fühlt sich zugehörig.
„Einheit ohne Anerkennung der sprachlichen Wirklichkeit ist ein Luftschloss.“
In Kamerun heißt das: Camfranglais und lokale Sprachen sind keine Störung, sondern gelebte Realität. Ein Bildungssystem, das sie ignoriert, produziert systematisch Scheitern und fördert Widerstand. Einheit ohne Anerkennung der sprachlichen Wirklichkeit ist ein Luftschloss.
Was beide Länder lernen können
Der 3. Oktober in Deutschland und der 20. Mai in Kamerun stehen für das gleiche Versprechen: Zusammenhalt. Doch beide Tage zeigen auch die Gefahr, wenn Einheit zu eng definiert wird. Politische Integration allein reicht nicht.
„Wer Mehrsprachigkeit als Defizit behandelt, verhindert Integration.“
Deutschland muss begreifen: Wer Mehrsprachigkeit als Defizit behandelt, verhindert Integration. Kamerun muss erkennen: Wer Vielfalt als Gefahr versteht, produziert Spaltung. Einheit gelingt nur, wenn Sprache als Ressource gesehen wird und nicht als Problem.
Lehre zum Feiertag
Einheit ist kein Feiertag. Einheit ist kein Dekret. Einheit ist ein Prozess. Ein Versprechen, das jeden Tag eingelöst werden muss. Ob in Deutschland oder in Kamerun: Einheit ohne Sprachvielfalt ist eine Illusion. Solange Sprachen verdrängt werden, gibt es keinen Zusammenhalt. Wer Einheit ernst meint, muss Sprache als Brücke begreifen. Erst dann ist Einheit mehr als ein Wort. Meinung
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Berlin-Monitor Jeder Dritte fühlt sich von Muslimen bedroht
- Das Repressionskarussell Erst gegen Geflüchtete – dann gegen alle
- „Perfide Menschenjagd“ CDU-Minister fordert Handyortung und Observation von…
- Keine Behörde ohne Rassismus Ataman: Innenminister Dobrindt ignoriert eigene…
- „Missbräuchliche Vaterschaft“ Wenn die Ausländerbehörde entscheidet, wer Vater ist!
- Flüchtlingspolitik Athen und Berlin planen Abschiebelager in Afrika
