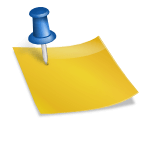Inländerdiskriminierung
Ehegattennachzug: Wenn der deutsche Pass zum Nachteil wird
Ehegatten von EU-Bürgern, Koreanern oder Brasilianern dürfen ohne Weiteres zu ihren Partnern nach Deutschland ziehen. Wer zu einem Deutschen ziehen will, muss erst einmal einen Sprachtest machen. Inländerdiskriminierung vom Feinsten.
Von Daniel Lautenbacher Mittwoch, 30.07.2025, 13:56 Uhr|zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 30.07.2025, 14:04 Uhr Lesedauer: 9 Minuten |
„Inländerdiskriminierung“ – ein Begriff, der vor allem von rechter Seite bemüht wird, um Stimmung zu machen. Doch was, wenn sich hinter dem Buzzword ein realer Missstand verbirgt, den ausgerechnet die politische Mitte übersieht? Der Streit ums Recht auf Familie und Sprachnachweise beim Ehegattennachzug zeigt: Zwischen Polarisierung und Schubladendenken bleibt das eigentliche Problem ungelöst – und das trifft alle.
Die größte Hürde beim Ehegattennachzug liegt darin, dass der nachziehende Ehepartner einen Sprachtest bestehen muss (§ 30 AufenthG). Dieses Erfordernis gilt aber nicht für alle, so sind etwa nachziehende Ehegatten beispielsweise aus Australien, Korea, Brasilien und Honduras von diesem Erfordernis befreit und müssen lediglich einen Antrag für ein Visum zum Ehegattennachzug stellen. Auch gibt es eine weitere relevante Ausnahme: Ehegatten aus nicht privilegierten Drittstaaten dürfen zu anderen EU-Bürgern, die in Deutschland leben, ebenfalls ohne Sprachnachweis nachziehen bzw. diese begleiten.
Diese Ungleichbehandlung wirft Fragen auf – denn oft ist es gerade der verlangte Sprachnachweis, der Paare zur Trennung zwingt. Meist muss der eine Partner schnell ins Zielland ziehen, um dort Arbeit und Wohnung zu finden, während der andere zurückbleiben muss. Genau dadurch entsteht überhaupt erst die Trennung, die einen Nachzug nötig macht. Ohne das Sprachnachweiserfordernis gäbe es in vielen Fällen gar keinen Grund für ein Nachzugsverfahren.
Das Problem wird besonders deutlich, wenn man sich folgenden Fall vorstellt: Eine deutsche Staatsbürgerin lebt mit ihrem Ehemann in Thailand. Dort führen sie gemeinsam ein normales Familienleben. Als die Frau eine gute Arbeitsstelle in Deutschland angeboten bekommt, möchten beide zusammen nach Deutschland ziehen. Obwohl sie bereits als Ehepaar zusammengelebt haben, darf ihr Mann nicht einfach mitkommen – er muss zuerst einen Sprachtest bestehen. Nur deshalb müssen sie sich trennen, obwohl sie eigentlich gemeinsam nach Deutschland ziehen wollen.
Rückkehrwillige deutsche Fachkräfte vs. Fachkräfte aus dem Ausland
Mit der Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts im Jahr 2022 wurden Familien von Auslandsdeutschen – die bereits vorher im Ausland zusammen gelebt haben – weiter benachteiligt. Denn mit diesem Gesetzespaket wurde auch beschlossen, dass die Ehepartner von Fachkräften aus dem Ausland keinen Sprachnachweis mehr erbringen müssen, wohingegen die Ehepartner von rückkehrwilligen deutschen Fachkräften weiterhin einen bestandenen Sprachnachweis als Einreisevoraussetzung vorweisen sollen.
In Folge dieser Änderung müsste beispielsweise die Ehefrau eines indischen IT-Experten keinen Sprachnacheis mehr vorlegen, während die indische Ehefrau des – im Ausland lebenden – deutschen IT-Experten weiterhin einen bestandenen Sprachtest vorweisen muss. Dies hat bei vielen Auslandsdeutschen – mit Partner aus Drittstaaten – das Gefühl der willkürlichen Ungleichbehandlung durch den Sprachnachweis noch weiter verstärkt.
Das Bundesinnenministerium (BMI) äußerte sich dazu wie folgt: „Eine Ungleichbehandlung könne allenfalls in den Fällen vorliegen, wenn der Deutsche mit seiner Ehegattin im Ausland lebt und diese beide gleichzeitig ihren Wohnsitz nach Deutschland verlagern wollen […].“ Gleichzeitig betonte das BMI, dass diese Ungleichbehandlung gegenüber anderen Ausländern durch das Interesse Deutschlands an der Gewinnung ausländischer Fachkräfte gerechtfertigt sein soll.
Verfassungswidrig?
Die Argumentation des BMI überzeugt jedoch nicht. Denn das Grundgesetz sieht in Art. 3 Abs. 1 GG vor, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz folgt das Verbot, wesentlich Gleiches willkürlich ungleich zu behandeln sowie wesentlich Ungleiches ohne sachlichen Grund gleichzustellen. Maßgeblich ist hierbei stets, ob ein hinreichender Differenzierungsgrund besteht, der die Ungleichbehandlung sachlich rechtfertigen kann.
Auch wenn bestimmte Nationalitäten – etwa aus Australien oder Korea – im Rahmen von bilateralen Abkommen vom Sprachnachweis befreit sind, muss eine solche Bevorzugung trotzdem fair und verhältnismäßig sein. Das heißt: Sie darf nur dann erlaubt sein, wenn sie einem sinnvollen Ziel dient und wirklich notwendig und angemessen ist.
Nehmen wir den beispielhaften Fall von Anna, einer deutschen Pflegekraft, die mit ihrem Ehemann Samuel aus Ghana in Accra lebt. Anna hat eine Stelle in einem deutschen Krankenhaus in Aussicht – ein Beruf, der in Deutschland dringend gebraucht wird. Trotzdem darf ihr Ehemann nicht einfach mitkommen: Er muss zuerst einen Sprachtest bestehen, der in Ghana oft schwer zugänglich oder mit langen Wartezeiten verbunden ist.
Ganz anders sieht es bei Carlos aus Mexiko aus, der eine IT-Stelle in Deutschland annimmt. Seine Ehefrau darf ihn begleiten – ganz ohne Sprachnachweis.
Beide Fälle betreffen Familien, die bereits zusammenleben und in Deutschland gebraucht werden. Beide wollen gemeinsam nach Deutschland einreisen. Trotzdem gelten unterschiedliche Regeln – nur weil Anna Deutsche ist und Carlos nicht.
Diese Ungleichbehandlung lässt sich kaum sachlich rechtfertigen. In beiden Fällen geht es um den Zuzug eines Ehepaares, bei dem eine qualifizierte Arbeitskraft nach Deutschland kommen will. Die Lebensgemeinschaft besteht bereits und soll lediglich von einem Drittstaat nach Deutschland verlagert werden. Die Ausgangslage ist also weitgehend identisch.
Auch das vom BMI vorgebrachte Argument, dass Drittstaatsangehörige mit ihren Familien nach einiger Zeit in ihr Herkunftsland zurückkehren, während deutsche Rückkehrer dauerhaft bleiben, überzeugt hier nicht. Es könnte genauso gut sein, dass der Ehepartner eines Deutschen sich in Deutschland nicht wohl fühlt und später wieder gehen will – oder dass auch Drittstaatsangehörige und ihre Familien dauerhaft bleiben möchten. Eine pauschale Unterscheidung ist an dieser Stelle weder verlässlich noch fair.
Genau deshalb erscheint es nicht mehr gerechtfertigt, von rückkehrwilligen deutschen Staatsbürgern weiterhin einen Sprachnachweis für ihre Ehepartner zu verlangen, während andere – wie Fachkräfte aus Drittstaaten – davon befreit sind. Diese Ungleichbehandlung könnte einen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes darstellen, welcher besagt, dass Gleiches nicht willkürlich ungleich behandelt werden darf. Das Grundgesetz garantiert mit Art. 3 Abs. 1 GG, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Daraus ergibt sich der sogenannte Gleichheitssatz, der verhindert, dass im Wesentlichen Gleiches ohne guten Grund unterschiedlich behandelt wird oder im Gegensatz hierzu Ungleiches ohne sachlichen Grund gleich behandelt wird. Entscheidend ist dabei immer, ob es einen nachvollziehbaren und gerechtfertigten Grund für die unterschiedliche Behandlung gibt. Fehlt ein solcher Grund, gilt die Ungleichbehandlung als verfassungswidrig.
Ein einfaches Beispiel: Stellen Sie sich vor, zwei Personen schwimmen unerlaubt in einem See. Das Gesetz sieht vor, dass Personen mit einem seriösen Haarschnitt nur eine Verwarnung erhalten, während Personen mit einem provokanten Haarschnitt eine hohe Geldstrafe zahlen müssen. Ohne einen nachvollziehbaren Grund, der diese Ungleichbehandlung rechtfertigt, wäre eine solche Regelung verfassungswidrig.
Bestand also bereits eine Lebensgemeinschaft im Ausland und möchte eine Auslandsdeutsche Fachkraft nach Deutschland zusammen mit einem Partner aus einem Drittstaat zurückkehren ist die Ausgangslage dieselbe. Damit dürfte der Sprachnachweis als Voraussetzung für den Ehegattennachzug in solchen Rückkehrfällen – spätestens seit der Gesetzesänderung 2022 – verfassungswidrig sein. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu steht allerdings bislang noch aus.
Risiken und Nebenwirkungen der deutschen Staatsbürgerschaft
Die Problematik betrifft nicht nur Auslandsdeutsche, sondern auch eingebürgerte Drittstaatler. Bei ihnen dürfte die Freude über die deutsche Staatsbürgerschaft meist sehr groß gewesen sein. Die damit einhergehenden Risiken und Nebenwirkungen wie ungewollte Trennungen und vermehrte Bürokratie im Kernbereich der Familie dürften aber die wenigsten erwartet haben.
Denn mit der Einbürgerung ändert sich vieles: Mit dem Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft gelten auch für deren Ehegatten die strengeren Erteilungsvoraussetzungen samt Sprachnachweis. Dies gilt selbst bei Doppelstaatlern mit einer anderen EU-Staatsbürgerschaft, wenn diese zuvor noch nie im EU-Ausland gelebt haben.
An dieser Stelle muss auch angemerkt werden, dass das konsequente Festhalten der Politik am Sprachnachweis vermutlich auch auf die hohe Zahl eingebürgerter Türkinnen und Türken zurückzuführen ist – schließlich wurde dieser Nachweis ursprünglich vor allem wegen dieser Bevölkerungsgruppe eingeführt und fußt zudem auf irrationalen Ängsten vor einem massenhaften Zuzug von Ehegatten aus der Türkei.
Auch das oft angeführte Argument, Zwangsheiraten durch „absichtliches Durchfallen“ beim Sprachnachweis zu verhindern, greift nicht. Die Vernehmung im Rahmen der Antragstellung erfolgt ohnehin ohne Begleitung – in diesem Rahmen hätte das Botschaftspersonal jederzeit die Möglichkeit, auf eine tatsächliche Zwangssituation aufmerksam zu werden. In der Praxis liegt in den meisten Fällen natürlich keine Zwangsehe vor – und bis heute gibt es keine belastbaren Belege dafür, dass der Sprachnachweis tatsächlich zur Verhinderung von Zwangsheiraten beigetragen hat.
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen: Wer als Partnerin oder Partner eines deutschen Staatsbürgers – egal welchen Migrationshintergrundes – in Deutschland nicht bereit ist, Deutsch zu lernen, wird dies auch nicht aufgrund eines Sprachnachweises tun. Vielmehr dient der Sprachnachweis als Instrument, um Ehepartner und Familien voneinander zu trennen – Beziehungen werden durch langwierige Verfahren, die sich oft über Jahre hinziehen, zermürbt oder schon im Vorfeld von den zahlreichen Hindernissen überschattet.
Unionsbürger
Ein ganz anderes Bild ergibt sich bei Unionsbürgern. Damit sind eigentlich alle Bürger der EU gemeint. In Bezug auf die Personenfreizügigkeit werden aber auch hier Deutsche wieder vom eigenen Staat benachteiligt. Denn EU-Bürger und deren Familienangehörige (auch aus Drittstaaten) haben Anspruch auf die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU, können also problemlos (und ohne Sprachnachweis) in ein anderes EU-Land ziehen. Deutsche können selbstverständlich ebenfalls in ein anderes EU-Land ziehen, das vorteilhafte Unionsrecht ohne Sprachnachweis findet jedoch bei Familienangehörigen von Deutschen in Deutschland keine Anwendung.
Vereinfacht ausgedrückt ist es Deutschland nämlich rechtlich gestattet, die eigenen Staatsbürger schlechter zu stellen als andere EU-Bürger. Denn die EU hat bei rein innerstaatlichen Sachverhalten aufgrund der nationalstaatlichen Souveränität keine Regelungskompetenz und somit kommt das familienfreundliche Unionsrecht nicht zur Anwendung. Nur in Fällen, in denen ein sogenannter „grenzüberschreitender Sachverhalt“ vorliegt, kann EU-Recht angewendet werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein deutscher Staatsbürger zusammen mit seiner Familie im EU-Ausland gelebt hat und nach Deutschland zurückkehrt. Dann ist auch hier kein Sprachnachweis mehr erforderlich.
Politische Zurückhaltung
Das Thema Inländerdiskriminierung ist komplex und emotional aufgeladen, was häufig zu vorschnellen Zuschreibungen und ideologischer Vereinnahmung führt. Vor diesem Hintergrund scheuen viele Parteien und Organisationen eine offene Auseinandersetzung mit der Problematik. Für die eine oder andere politische Kraft könnte sich diese Zurückhaltung in der derzeit eher migrationskritisch geprägten Debattenlage sogar als strategisch günstig erwiesen haben. So wurde die im letzten Koalitionsvertrag vorgesehene Abschaffung des Sprachnachweises von der damaligen Bundesregierung nicht umgesetzt – und fand im aktuellen Koalitionsvertrag überhaupt keine Berücksichtigung mehr.
Die Lösung des Problems liegt aber nicht in einer Schlechterstellung von Ausländern, sondern vielmehr in der Gleichstellung der eigenen Staatsbürger mit europäischen Wertvorstellungen. Daher sollte Deutschland – wie z. B. die mit gutem Beispiel vorangehende Tschechische Republik – die eigenen Staatsbürger beim Thema Ehegattennachzug mit freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern gleichstellen und endlich vom Sprachnachweis absehen. Ein solcher Ansatz würde nicht nur die verfassungsrechtlichen Bedenken adressieren, sondern auch die Attraktivität Deutschlands für rückkehrende Fachkräfte erhöhen.
Erst wenn auch kleinere, bislang oft übersehene Gruppen von Betroffenen in den Blick genommen und gerecht behandelt werden, eröffnen sich Chancen, größere migrationspolitische Herausforderungen auf konstruktive Weise zu lösen. Die Anerkennung und Gleichbehandlung aller Betroffenen kann so zu einem wichtigen Schritt hin zu einer solidarischeren und rechtlich kohärenteren Migrationspolitik werden – zum Nutzen aller in unserer Gesellschaft. (mig) Aktuell Panorama
Wir informieren täglich über das Wichtigste zu Migration, Integration und Rassismus. Dafür wurde MiGAZIN mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Unterstüzte diese Arbeit und verpasse nichts mehr: Werde jetzt Mitglied.
MiGGLIED WERDEN- Neue Entwicklungspolitik Alabali Radovan: Deutschland gibt Kampf gegen…
- Wahlkampf in Bayern AfD will Einbürgerung nur noch für Reiche –…
- Sachsen Über 600 Kinder ohne Schulplatz – alle ohne deutschen Pass
- „Stoppt die Boote“ Britische Rechtsextremisten jagen Geflüchtete an…
- Minnesota Das Unvorstellbare ist näher, als wir denken
- Bundesagentur Ohne ausländische Beschäftigte geht es nicht mehr